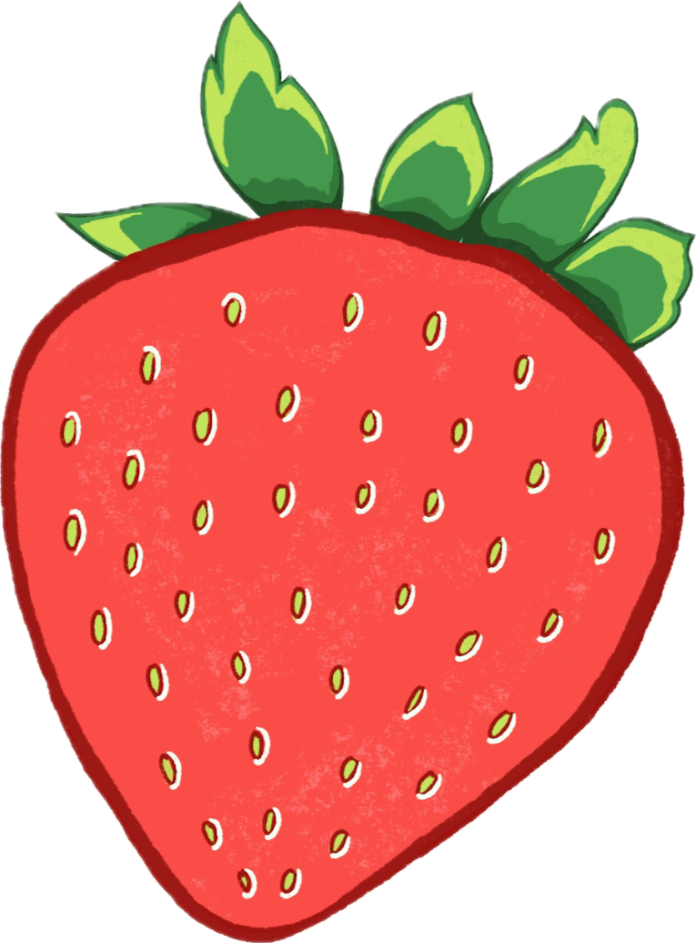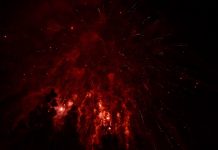Extremwetter nehmen zu. In Hamburg müssen Landwirtschaftliche Betriebe lernen mit anhaltender Trockenheit und Starkregen umzugehen. Eine Bestandsaufnahme beim Erdbeerhof Glantz.
Die Erdbeersaison läuft auf Hochtouren. Enno Glantz, Geschäftsführer des Erdbeerhofs Glantz, zeigt sich zur Halbzeit der Saison zufrieden, trotz sechswöchiger Trockenheit. Je mehr Sonne, desto mehr Geschmack, sagt Glantz, der den Hof in siebter Generation führt. Erdbeeren von seinen Höfen in Delingsdorf und Hohen Wieschendorf vertreibt er an über 150 Ständen und auf acht Selbstpflückfeldern rund um Hamburg.
Erdbeeren unter Extremwetter
Optimal für die Erdbeeren wären laut Glantz 20 bis 25 Grad tagsüber und Regen in der Nacht. Denn nachts wird nicht geerntet und die Pflanzen können dann das Wasser besser aufnehmen.
Doch die Realität auf dem Feld sieht anders aus: Zwischen Anfang April und dem 20. Mai diesen Jahres blieb der Regen weitgehend aus. Drei- bis viermal pro Woche musste bewässert werden. Das Wasser kam aus einem Tiefbrunnen. Die Erdbeeren haben durch die Bewässerung „Nasse Füße und trockene Köpfe”, sagt Enno Glantz. Normalerweise wird auf seinen Feldern einmal pro Woche bewässert.
Erst Mitte Mai kam endlich der ersehnte Niederschlag: „Das war fünf Minuten vor zwölf“, so der Unternehmer. Die Dürre stresse die Erdbeere. Durch starke Sonneneinstrahlung würden die Früchte zwar süßer schmecken, aber auch schneller reifen. An Tagen mit 25 bis 30 Grad steige der Ertrag. Je wärmer es wird, desto kürzer sei die Ernteperiode. Was den Früchten Aroma verleihe, verkürze zugleich die Saison.
„Die Felder sind früher leer, schon im Mai mussten erste Selbstpflückfelder vorübergehend schließen.“ Die Felder waren aufgrund des sonnigen Wetters gut besucht, doch die Erdbeeren wurden nicht schnell genug rot. Normalerweise, wie auch im letzten Jahr, dauert die Saison bis Ende Juli, kleine Mengen können bis Mitte August verkauft werden. Doch laut Glantz verdichtet sich die Saison zunehmend: „Geballter, kürzer, intensiver.“ Hohe Temperaturen, wie zuletzt in Hamburg, erschweren die Planung für den Erdbeerhof.
Trockenheit ist der angenehmere Gegner
So unangenehm anhaltende Trockenheit sei, gegen Starkregen sieht Glantz diese als das kleinere Übel. „Bei starkem Regen werden die Erdbeeren weich, bekommen Druckstellen, die kann man nicht mehr verkaufen.“ In einem Jahr habe der Betrieb durch zu viel Regen 30 bis 40 Prozent der Ernte verloren. Auch später Bodenfrost, wie etwa die Nachtfröste Mitte Mai, die sogenannten Eisheiligen, seien ein Problem: „Wenn die Blüte draußen ist und es dann nochmal richtig kalt wird, war’s das. Und das passiert nicht selten, sondern regelmäßig.“
Eine schwächere Ernte bedeutet aber nicht automatisch höhere Preise. Glantz bleibt realistisch: Die Kundschaft akzeptiere dies nicht.
Hamburgs Böden haben unterschiedliche Bedingungen
Genau wie Glantz Erdbeerfelder ist laut der Landwirtschaftskammer Hamburg auch der Obstbau im Alten Land von Hagel und Spätfrost bedroht. Ob Trockenheit oder Starkregen schwerer wiege, sei regional verschieden. Auf dem Marschboden – wie beispielsweise im Alten Land – kämpfe die Landwirtschaft Hamburgs stärker mit Starkregen, während es auf der sandigeren Geest vor allem anhaltende Trockenheit sei, die Probleme bereite, so Carola Bühler vor der Landwirtschaftskammer Hamburg. Hamburgs Felder würden bislang kaum bewässert. Einige Betriebe versuchten, sich durch angepasste Bodenbearbeitung auf trockene Phasen vorzubereiten. Eine häufigere und intensive Bearbeitung des Bodens solle vermieden werden, um die Feuchtigkeit besser zu halten. Voraussetzung dafür sei allerdings eine frühzeitige Wetterprognose, so Bühler weiter.
Laut einer Studie der Standford Universität aus dem Jahr 2021 wird die Vorhersagbarkeit des Wetters durch den Klimawandel zunehmend erschwert. Die Forschenden zeigen, dass bereits wenige Grad Erwärmung ausreichen, um die Zuverlässigkeit von Wettermodellen deutlich zu senken. Insbesondere in den mittleren Breiten, also auch in Hamburg, verkürzt sich das Zeitfenster für verlässliche Prognosen bei steigenden Temperaturen auf wenige Stunden bis Tage.
Die Menschheit unterschätzt die Klimafolgen
Was Enno Glantz auf seinen Feldern erlebt, ist Teil eines größeren Zusammenhangs. Der Wetter- und Klimaexperte Frank Böttcher ordnet ein: Die Veränderung des Klimas verlaufe aktuell rasant. Heute liege Deutschland bei einer durchschnittlichen Erwärmung von über zwei Grad im Vergleich zur Vorindustriellen Zeit.
„Im Mai dieses Jahres waren wir bei 430 ppm in der Atmosphäre.” 430 ppm steht für 430 parts per million (dt.: Teile pro Millionen) und wird im Kontext der Konzentration des Gases Kohlendioxid (CO2) in der Luft verwendet. Es bedeutet, dass auf eine Million Luft-Moleküle 430 Kohlendioxid-Moleküle, also CO2, kommen. Das bedeute, dass wir im Klimasystem uns bereits stand heute auf eine Erwärmung von rund 3,5 Grad einstellen können, so Böttcher weiter.
Die Menschheit unterschätze weiterhin, wie dramatisch die Folgen sein werden. „Wir wissen, wie eine Drei-Grad-Welt aussieht, das hatten wir zuletzt im Pliozän”, erklärt der Meterologe. “Pliozän” beschreibt eine geologische Epoche und gilt als die letzte warme Klimaperiode, bevor das Eiszeitalter begann. Wie die Erde damals aussah? „In dem Pliozän lag der Meeresspiegel 20 Meter höher,“ so Böttcher.
Hamburg wäre in diesem Szenario, mit einem angestiegenen Meeresspiegel um 20 Meter, teilweise überflutet. Das bedeuted: Alles, was heute nur wenige Meter über dem Meeresspiegel liegt, würde dauerhaft überflutet werden. Darunter die Innenstadt, der Hafen, Altona, Wilhelmsburg, Harburg. Auch andere Stadtteile, wie St. Pauli, Barmbek, Winterhude oder Rotherbaum wären stark gefährdet oder nicht mehr bewohnbar.
Laut des Hamburger Küstenhochwasserschutzes schützen die heutigen Deiche in Hamburg gegen Sturmfluten von maximal ca. acht bis neun Metern, nicht gegen einen Dauermeeresspiegel von 20 Metern.
Hamburgs Sommer werden wärmer
Für die Hamburger Sommer prognostiziert Böttcher auch langfristig einen Anstieg der Temperatur. Zwischen 1961 und 1990 wurden innerhalb von 30 Jahren insgesamt 71 Tage mit über 30 Grad gemessen. Böttcher geht davon aus, dass es bis 2050 über 400 solcher Tage geben könnte. Hamburg bewege sich damit klimatisch in Richtung Norditalien: “Hamburg rutscht also in die frühere Klimazone Norditaliens. Es wird im Sommer sehr viel heißer. Es wird längere Dürrephasen aber auch mehr Starkregen geben.”
Für die Landwirtschaft bedeutet dies einen drastischen Wandel. Böttcher sieht eine Anpassung als unausweichlich. Sorten müssen trockenresistenter werden, Wasser muss effizienter genutzt und Äcker besser vor Erosion geschützt werden. „In unseren Städten und Wäldern wird es völlig neue Pflanzensorten geben“, sagt er. Als einheimisch geltende Pflanzen sind nicht unbedingt anpassungsfähig an ein neues Klima. Wer heute Bäume pflanzt, müsse bedenken, dass sie in 30 Jahren mit dem Klima Spaniens zurechtkommen müssen.
„Am Ende sind wir abhängig vom Wetter“
Eine seriöse Prognose, wie heiß oder trocken der Sommer 2025 in Hamburg wird, ist laut Böttcher nicht möglich. Nur eines ist sicher: Das Wetter bleibt unberechenbar. Trotz Bewässerungssystemen und durchdachter Organisation ist die Landwirtschaft den Launen des Wetters ausgeliefert.
Glantz erklärt: „Wenn wir in so eine Wettermisere hineinkommen, haben wir eben höhere Erntekosten. Dann müssen wir schauen, dass wir Rücklagen haben und es beim nächsten Mal besser machen. So einfach ist das eigentlich.“ Glantz sieht seinen Betrieb durch den Klimawandel aktuell nicht gefährdet. Viel problematischer sei der wirtschaftliche Druck, vor allem durch den vergleichsweise hohen Mindestlohn in Deutschland im europäischen Vergleich.
Werden Lebensmittel aus der Hamburger Landwirtschaft teurer?
Eine eindeutige Aussage zu steigenden Preisen sei laut der Landwirtschaftskammer Hamburg schwierig. Diese hängen nicht nur von Wetter und Ernte, sondern auch stark vom Markt ab. Die Landwirtschaftskammer spreche allerdings für die gesamte Landwirtschaft, nicht ausschließlich für die Nahrungsmittelproduktion.
Auch Enno Glantz kann keine Prognose abgeben. Er könne nicht vorhersagen, welche Rolle die Anpassung an Klimafolgen in der Preisentwicklung der Erdbeeren spielen wird. Klar sei aber: Wenn sich trockene Perioden und Starkregen häufen und der Umgang damit höhere Kosten verursacht und es zu schwächeren Erträgen kommt, müsse Glantz irgendwann den Grundpreis der Beeren anpassen. Für die laufende Saison hofft er auf stabile Bedingungen: Sonne für die Süße, Regen zur richtigen Zeit. Und auf Kund*innen, die bereit sind, für regionale Qualität einen fairen Preis zu zahlen. Denn: „Importware ist klimafeindlich, schmeckt nicht und ist nicht gesund, weil sie eben alt ist.“
Wenn Kund*innen zur Erdbeere greifen, dann am besten zur regionalen, frischen Frucht. Das wäre zumindest in Glantz’ Sinne. Damit – auch aus Klimaschutzgründen – der regionale Anbau bestehen bleibt.