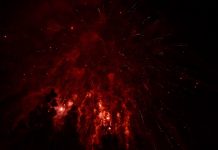Die Temperaturen in Hamburg steigen jährlich. Was droht, wenn die Sommer immer heißer werden? Und was tut die Stadt Hamburg, um Obdachlose vor der Hitze zu schützen?
Es ist 20:15 Uhr. Die Hitze hängt schwer in der Luft – 34 Grad Celsius zeigte das Thermometer am 1. Juli 2025 in Hamburg. Für viele ist jetzt Prime-Time: Zuhause ankommen, Füße hochlegen, durchatmen. Wo für die meisten die entspannte Zeit des Tages anfängt, beginnt für einige Menschen ein ganz anderer Teil des Alltags.
Vor dem Media Markt am Hauptbahnhof steht der Mitternachtsbus der Diakonie Hamburg. Eine lange Schlange hat sich gebildet – Menschen warten auf Wasser oder eine Mahlzeit. Der Bus fährt jeden Abend die Orte an, an denen obdachlose Personen schlafen. Besonders bei hoher Hitze wird hier Wasser in Tetra Paks ausgegeben, damit die Menschen auch nachts etwas zu trinken haben.

Tödliche Hitze
Drei Jahre zuvor, am 20. Juli 2022 stieg die Temperatur in Hamburg erstmals über 40 Grad Celsius. Am Ende dieses Sommers sind in Hamburg 160 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben. Das sind mehr Menschen als Wörter, die Du bis hier in diesem Text gelesen hast.

Im gleichen Zeitraum starben im gesamten Bundesgebiet 8600 Menschen an den Folgen der extremen Hitze. Das sind mehr Personen, als das Schanzenviertel in Hamburg Einwohner*innen hat.
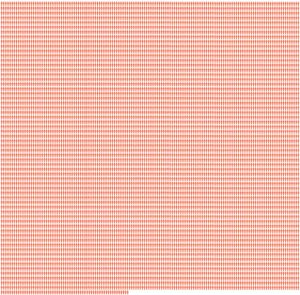
Der menschengemachte Klimawandel
2014 überschritt die Jahresmitteltemperatur in Deutschland das erste Mal seit Beginn der Aufzeichnungen 10 Grad Celsius. Ein neuer, trauriger Rekord. 2018 lag das Mittel bereits bei 10,45 Grad Celsius, 2022 bei 10,52 Grad Celsius und seitdem steigt der Wert weiter. Für den Sommer 2022 errechnete der Deutsche Wetterdienst eine Mitteltemperatur von 19,2 Grad Celsius. Er ist damit einer der wärmsten Sommer seit 1881.
Durch den menschengemachten Klimawandel werden auch in Deutschland die Sommer immer heißer. Von 1960 bis 2023 ist die Mitteltemperatur in den Sommermonaten kontinuierlich gestiegen und ist im Jahr 2023 im Durchschnitt 2,7 Grad Celsius höher als im Jahr 1960.
Das Robert Koch-Institut veröffentlicht wöchentlich Berichte zur „hitzebedingten Mortalität” – also Sterblichkeit, die durch Hitze beeinflusst wird. Das Institut untersucht die erhöhte Anzahl von Todesfällen innerhalb eines bestimmten Zeitraums im Vergleich zu dem, was unter normalen Bedingungen zu erwarten wäre. Dabei wird deutlich: In heißen Zeiten sterben mehr Menschen als in kältere Zeiten.
Vergleicht man zum Beispiel Sterbefälle mit der Sommermitteltemperatur zwischen 2000 und 2023, fällt auf: In Jahren mit erhöhter Sommermitteltemperatur sind in Deutschland deutlich mehr Menschen an den Folgen extremer Hitze gestorben.
Besonders heiß und damit tödlich war dabei der Sommer im Jahr 2003. In diesem Jahr starben in Deutschland 11.600 Menschen hitzebedingt. Zwischen 2012 bis 2023 gab es doppelt so viele Hitzesommer wie in der Zeitspanne zwischen 2000 und 2011. In dem Zeitraum starben fast 25 Prozent mehr Menschen, also 13.100, an den Folgen der extremen Hitze.
Warum sterben Menschen an Hitze?
Ein sogenannter „Hitzeschlag” kann tödlich sein. Der Körper überhitzt durch hohe Temperaturen oder Anstrengung in stickiger Umgebung. Bei extremer Hitze kann er die Wärme nicht schnell genug abgeben. Die Körpertemperatur steigt, bis zu teilweise 41 Grad Celsius kann sie erreichen. Bei hohen Temperaturen können unsere Organsysteme schlechter arbeiten. Deswegen kann Hitze auch zu Schäden an lebenswichtigen Organen wie Herz, Lunge und Gehirn führen. Menschen mit Vorerkrankungen dieser Organe, häufig ältere Menschen, und kleine Kinder sind besonders gefährdet.
Symptome eines Hitzschlags können Müdigkeit, Kopfschmerz und Erbrechen sein, Betroffene können jedoch auch bewusstlos werden und ins Koma fallen. Laien können die Ernsthaftigkeit der Situation von außen oft schlecht einschätzen. Deswegen gilt: Ist eine Person nach dem Aufenthalt in der Hitze verwirrt, hat Krämpfe oder droht, bewusstlos zu werden, muss sofort ein Notruf getätigt werden.
Obdachlose sind besonders betroffen
Besonders betroffen sind unter anderem Obdachlose. „Viele obdachlose Menschen sind vorerkrankt, da kommt die Hitze on-top. Wenn ich gesundheitlich angeschlagen bin und etwa eine Herz-Kreislauf-Krankheit habe, vertrage ich die Hitze noch schlechter”, sagt Corinna Schnaus, eine der beiden Projektleiterinnen des Mitternachtsbusses. “Obdachlose leiden daher noch mal mehr darunter, wenn Schattenplätzen fehlen oder Trinkwasser.”
So zeigte eine Befragung von Obdachlosen, die sogenannte National Survey on Psychiatric and Somatic Health of Homeless Individuals (kurz NAPSHI) aus dem Jahr 2021, dass knapp 40 Prozent der Obdachlosen über Symptome berichten, die auf eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hindeuten. Für die Studie befragten die Forschenden 651 Obdachlose in den Großstädten Hamburg, Frankfurt, Leipzig und München, sowie in Wiesbaden, Halle und Augsburg und Mainz.
Die Zahl der Obdachlosen steigt
Bundesweit leben in Hamburg pro 10.000 Einwohner*innen die meisten Obdachlosen.
Der Wohnungslosenbericht der Bundesregierung, der Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, zeigt: Die Zahl der obdachlosen Menschen in Hamburg nimmt zu. 2002 wurden laut eines im Jahr 2018 erschienenen Berichts der Gesellschaft für Organisation und Entscheidung (GOE) rund 1281 obdachlose Menschen erfasst. Die GOE Bielefeld führt sozialwissenschaftliche Analysen, Evaluationen und Dokumentationen durch, um Unternehmen, Organisationen und Institutionen bei Entscheidungsfragen zu unterstützen. Mehr als zwanzig Jahre später hat sich diese Zahl dem Bericht der Bundesregierung zufolge fast verdreifacht. 2024 wurden in Hamburg 2787 Menschen gezählt, die auf der Straße leben.
Alex, 69 Jahre alt, ist einer dieser über 2000 obdachlosen Menschen in Hamburg. Er nutzt Hilfsangebote von ehrenamtlichen Helfer*innen und Organisationen – wie dem Deutsche Rote Kreuz oder dem Mitternachtsbus der Diakonie Hamburg. Alex meint, Hamburg sei im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland gut aufgestellt: „Hier verhungert und verdurstet keiner.” Das zieht aus seiner Sicht auch andere Obdachlose nach Hamburg.
Täglich passieren etwa 550.000 Menschen den Hamburger Hauptbahnhof. So viele wie an keinem anderen Bahnhof in Deutschland. Rund um den Bahnhof stehen nur vereinzelt einige Bäume; die Umgebung ist überwiegend von Stahl und Beton geprägt.
Hitzeinsel Hamburg
„Auf den versiegelten Flächen halten sich auch die meisten obdachlosen Menschen auf – generell im Innenstadtbereich”, erzählt Corinna Schnaus.
Bereiche, die stark versiegelt sind – also Boden, der luft- und wasserdicht abgedeckt ist, zum Beispiel durch Asphalt oder Beton – wärmen leichter auf. Denn versiegelte Flächen speichern deutlich mehr Sonnenenergie als natürliche Oberflächen wie Wiesen oder Wälder. Diese Energie wird als Wärme abgegeben und lässt die Umgebungstemperatur steigen. In besonders stark versiegelten Stadtteilen ist es dadurch deutlich heißer. Dieses Phänomen ist als „Wärmeinseleffekt” bekannt.
In den versiegelten Stadtteilen gibt es kaum Schutz vor Hitze. Jens, 68 Jahre alt, ist seit einigen Jahren obdachlos und erzählt, dass er an heißen Tagen die Stadt verlässt und zum Timmendorfer Strand zum Baden fährt: „Bei über 30 Grad halte ich es in der Stadt nicht aus.” Auch Alex hält es bei hohen Temperaturen nur im Park aus, erzählt er.
Große Unterschiede in der Stadt
Diese Recherche basiert in Teilen auf einer Kooperation von FINK.Hamburg mit Correctiv und Vertical52. Das Lokaljournalismus-Netzwerk Correctiv.Lokal recherchiert zu verschiedenen Themen, darunter in einem Schwerpunkt über die Klimakrise. Weitere Infos unter correctiv.org/klima.
Wie unterschiedlich sich die Versiegelungsgrade der Stadtteile in Hamburg auswirken, zeigt der Vergleich von Blankenese und Hammerbrook: Während Blankenese direkt an der Elbe liegt und von viel Grün umgeben ist, dominiert in Hammerbrook Beton. Das macht sich bei den Oberflächentemperaturen bemerkbar: In einer Recherche von Correctiv und Vertical52 wurde die durchschnittliche Oberflächentemperatur an Sommertagen in 2023 und 2024 gemessen. Das Ergebnis: Blankenese war 3,3 Grad kühler, Hammerbrook dagegen 5,4 Grad wärmer als der Hamburger Durchschnitt. 2024 war Hammerbrook zu 78 Prozent versiegelt, Blankenese nur zu 18 Prozent.
Versiegelung verstärkt Hitze
Correctiv und Vertical52 haben zudem 2023 und 2024 die Städte Leipzig, Stuttgart und Hamburg mithilfe von Satellitendaten auf ihre Flächenversiegelung untersucht. Das Ergebnis: Keine der beiden Vergleichsstädte ist so stark versiegelt wie Hamburg. Zwischen 2018 und 2024 wurden in Hamburg rund 14 Quadratkilometer neu versiegelt – das entspricht etwa 1960 Fußballfeldern.
Auffällig ist: Wo die Oberflächentemperatur in Hamburg überdurchschnittlich hoch ist, ist die Stadt auch in hohem Maße versiegelt. Davon sind besonders die Stadtteile im Hamburger Zentrum betroffen. Und dort nimmt die Versiegelung weiter zu. Ein Vergleich mit 2018 zeigt: In fast allen Innenstadtvierteln hat sich die versiegelte Fläche vergrößert.
Bereits 2015 prognostizierte der Deutsche Wetterdienst einen Anstieg von Hitzeperioden und Starkregen bis 2050 in Hamburg. Versiegelte Flächen verstärken beide Risiken: Hitze kann sich stauen, Starkregen kann schlechter versickern. Überflutete Straßen, Parkhäuser oder Keller sind die Folge – vor allem in dicht bebauten, stark versiegelten Stadtteilen, in denen viele obdachlose Menschen Zuflucht suchen.
Trinkwasser ist Hitzeschutz

Nicht nur der Mangel an Zufluchtsorten für Obdachlose ist bei extremer Hitze ein Problem. „Mehr zu trinken” gehört zu den wichtigsten Selbstschutzmaßnahmen bei Hitze – auch beim Aufenthalt im öffentlichen Raum”, heißt es im Hitzeaktionsplan der Stadt Hamburg. Dieser beinhaltet Strategien zum gesundheitlichen Schutz von Bürger*innen. Vor allem vulnerable Gruppen, also Menschen, für die die Hitze besonders gefährlich ist, nimmt der Plan in den Blick. Dazu gehören neben Obdachlosen beispielsweise Alte, Schwangere, und Menschen mit Behinderung.
Auch das Bundesgesundheitsministerium (BMG) warnt in seinem Leitfaden für Hitzeschutz für obdachlose Menschen: Eingeschränkter Zugang zu Trinkwasser und Flüssigkeitsmangel stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko für obdachlose Menschen dar.
Es mangelt an Trinkbrunnen
In Hamburg gibt es aktuell 54 öffentlich zugängliche Trinkwasserbrunnen. Damit schneidet Hamburg im bundes- und europaweiten Vergleich schlecht ab. Während europäische Großstädte wie Paris oder Wien auf ein engmaschiges Netz an öffentlichen Trinkwasserquellen setzen, müssen Menschen in Hamburg oft gezielt nach einem Brunnen suchen. Auch in anderen deutschen Großstädten wie Berlin und München gibt es zwar nicht viele Trinkbrunnen, aber immer noch mehr als in Hamburg.
Keine Pläne für neue Trinkbrunnen
Jens, der jeden Abend zum Mitternachtsbus für Wasser und andere Getränke geht, reicht das öffentliche Angebot nicht: „Mehr Trinkwasserbrunnen wären gut. Zum Beispiel rund um das Rathaus und in der Innenstadt.” Alex sagt: „Wenn es die Ehrenamtlichen nicht geben würde, würden die Trinkwasserbrunnen nicht ausreichen. Davon gibt es deutlich zu wenige.”
Auf Anfrage teilte die Umweltbehörde mit, sie wolle die Anzahl der Trinkwasserbrunnen mittelfristig ausbauen. Konkrete Standorte gebe es dafür derzeit noch nicht.
Jeder kann helfen
Ergänzend zu den städtischen Brunnen gibt es in Hamburg sogenannte „Refill”-Stationen, die das Trinkwasserangebot im öffentlichen Raum erweitern sollen. Unternehmen und Läden signalisieren per „Refill”-Aufkleber, dass man bei ihnen kostenlos Trinkwasser bekommen kann.
Sonja Norgall, die andere Projektleiterin des Mitternachtsbusses, meint: „Wenn jemand obdachlos ist, dann schämt sich die Person häufig in einen Laden reinzugehen, denn sie ist eben nicht der klassische Kunde.” Corinna Schnaus ergänzt: „Deshalb bräuchte es eigentlich noch mehr städtische, wirklich freistehende, ganz niedrigschwellige Wasserangebote.”
Über Trinkwasserbrunnen und ehrenamtliche Arbeit hinaus, sei es wichtig als Bevölkerung aufeinander zu achten. Schnaus betont: „Es ist kein großer Aufwand kurz am Kiosk eine Flasche Wasser für jemanden zu besorgen. Das kann bei 35 Grad wirklich einen Unterschied machen.”

Am Hauptbahnhof macht sich der Mitternachtsbus in der heißen Sommernacht auf den Weg zum nächsten Halt an der St. Petri Kirche. In den kommenden Jahren wird er es vermutlich immer häufiger tun.