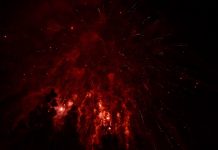Marie Nejar trat in NS-Propagandafilmen auf, war Schlagersängerin und kämpfte ihr Leben lang dafür, dazuzugehören. Eine der letzten bekannten Schwarzen NS-Zeitzeuginnen ist vor einem halben Jahr verstorben. Über ihr Leben wird aber selten erzählt. Ein Nachruf.
Die Hamburgerin Marie Nejar spielte in zahlreichen Filmen des Dritten Reiches mit. Nicht als glamouröse Hauptfigur. In „Münchhausen“ gab sie eine unterwürfige Dienerin an der Seite des weißen Starschauspielers Hans Albers. In „Quax in Afrika“ spielte sie eine rassistisch „exotisierte“ afrikanische Prinzessin. Marie Nejar, eine der letzten bekannten Schwarzen NS-Zeitzeuginnen, war Teil des Systems – um das System zu überleben. Und sie war Teil einer Schwarzen Community, die es auch während und bereits vor der NS-Diktatur in Deutschland gab. Noch bis zu ihrem Tode erinnerte sie an die Schrecken der Nazizeit.
Die Schicksale vieler Minderheitsgruppen im Dritten Reich sind genau dokumentiert. Wie die Lebensrealität Schwarzer Menschen während dieses düstersten Kapitels deutscher Geschichte aussah, bleibt allerdings oft ungesehen. Umso wichtiger sind Zeitzeug*innen, die diese Periode miterlebt und überlebt haben – die darüber berichten. Mit Marie Nejar ist am 11. Mai 2025 eine der letzten offiziell dokumentierten Schwarzen Zeitzeug*innen verstorben.
Wir schreiben „Schwarz” bewusst groß. Der Begriff beschreibt eine politische Realität und gesellschaftliche Struktur – keine biologischen Merkmale.
Das Schicksal Marie Nejars ist für das Verständnis von Schwarzen Lebensrealitäten zwischen 1933 und 1945 von großer Bedeutung. Die Hamburgerin wurde als Kind von den Nazis für deren rassistische Propaganda genutzt, machte später Karriere als Schlagersängerin in der jungen Bundesrepublik Deutschland und arbeitete danach mehrere Jahrzehnte als Krankenschwester in Hamburg.
Geboren wurde sie 1930 in Mühlheim an der Ruhr. Ihre leibliche Mutter Cécilie war die Tochter der deutschen Artistin Marie Wüstenfeld und des aus Martinique stammenden Joseph Néjar. Ihr leiblicher Vater war ein Seemann aus Ghana. Als Kind zog Marie zu ihrer Großmutter nach Hamburg und lebt mit dieser fortan auf St. Pauli.
Die Community ist schon 100 Jahre alt
Als Marie Nejar in den frühen 1930er-Jahren in die Hansestadt kam, waren Schwarze Menschen bereits im Stadtbild vertreten. Die internationale Seefahrt aber auch die deutsche Kolonialzeit hätten rund um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert dafür gesorgt, dass sich eine Schwarze Community gebildet habe, erklärt Tahir Della, Sprecher der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD). Die ISD wurde Mitte der 1980er-Jahre gegründet mit dem Ziel, Biografien Schwarzer Menschen sichtbar zu machen und Kolonialismus aufzuarbeiten.
Laut Della sei es wahrscheinlich, dass heute noch Schwarze Zeitzeug*innen der NS-Zeit leben, die aber unbekannt seien. „Ich gehe davon aus, es gibt noch wesentlich mehr, die gar nicht unbedingt in Deutschland leben müssen“, so Tahir Della. Im frühen 20. Jahrhundert gab es ihm zufolge eine „lange Zeit der Migration“ aus der Karibik und Afrika, durch die sich schützende Strukturen für Schwarze Menschen gebildet hätten.
Als Beispiel nennt er die Ligue de défense de la race nègre, eine in den 1920ern in Frankreich gegründete Bürgerrechtsorganisation, die sich dem Kampf gegen Kolonialismus und Rassismus verschrieb. In Deutschland arbeitete sie mit kommunistischen Organisationen zusammen, engagierte sich gegen Rassismus und Kolonialismus und organisierte in Berlin 1930 die Theaterrevue „Sonnenaufgang im Morgenland“. Auch in Hamburg soll es eine Regionalgruppe gegeben haben.
Schwarze Menschen werden isoliert
Marie Nejar war das einzige schwarze Kind in ihrem direkten Umfeld. Ihre weißen Freund*innen verteidigten sie zwar gegen diskriminierende Zuschreibungen, Beleidigungen und Alltagsrassismus, stellten klar, dass sie Marie nicht wegen ihrer Hautfarbe ausgrenzen wollen. Das erzählte sie in einem Interview mit Schwarzrotgold tv, ein Medienprojekt des Moderators Jermain Raffington, das schwarze Vorbilder in Deutschland sichtbar machen soll. Trotzdem erlebte Nejar spätestens mit der Machtergreifung durch die Nazis 1933 mit, dass sie gesellschaftlich eben doch anders wahrgenommen und behandelt wird als ihre weißen Mitschüler*innen.
Schwarzen Menschen wurde nun die Staatsbürgerschaft entzogen und „spätestens 1933 gab es keinerlei Schutzmechanismen und -strukturen rechtlicher oder sozialer Art“, erklärt ISD-Sprecher Della und bezieht sich dabei auch auf sämtliche andere marginalisierte Gruppen wie Sinti und Roma oder Menschen mit Behinderung. Ihm zufolge konnten Schwarze Menschen in dieser Zeit oft nur überleben, indem sie ihre Würde aufgaben und sich für das System „nützlich“ machten.
Marie Nejar als Teil der NS-Propaganda
Marie Nejar ging in die Unterhaltungsindustrie: 1942 nach Potsdam-Babelsberg in die UFA-Filmstudios, die von Joseph Goebbels für die NS-Propaganda instrumentalisiert wurden. Gemeinsam mit anderen Schwarzen, darunter auch Theodor Wonja Michael, ebenfalls politisch engagierter Zeitzeuge, war Marie Nejar Anfang der 1940er-Jahre in stereotypisierten Nebenrollen zu sehen.
So war sie im 1943 erschienenen „Münchhausen“ eine unterwürfige Dienerin an der Seite des weißen Starschauspielers Hans Albers oder spielte in „Quax in Afrika“ eine Nebenfigur als rassistisch „exotisierte“ afrikanische Prinzessin. Die diskriminierenden Zuschreibungen ihrer Rollen dienten der NS-Propaganda. Trotzdem halfen diese Filmjobs vielen Schwarzen Menschen: Durch die gemeinsame Arbeit an Sets konnten sie sich vernetzen und gegenseitig bei der Beschaffung von Papieren und Essensmarken helfen.
Marie Nejar lernte so nicht nur Theodor Wonja Michael, sondern auch andere Zeitzeug*innen kennen, darunter Fasia Jansen und Hans-Jürgen Massaquoi. Ihre Arbeit für die Propagandamaschinerie der Nazis half ihr, die NS-Diktatur zu überstehen.
Schlagerkarriere als „Leila Negra“
Wenige Jahre nach Kriegsende 1945 wurde Marie Nejar in einer Strandhalle an der Ostsee vom Musikproduzenten Gerhard Mendelson entdeckt. Sie ging dort eigentlich einem Gelegenheitsjob nach, wurde bei einer spontanen Gesangseinlage aber von Mendelson gehört, der ihr einen Plattenvertrag anbietet. Ihre Karriere als Schlagersängerin „Leila Negra“ startete kurz darauf. Marie Nejar wurde, obwohl eigentlich schon in ihren Zwanzigern, als Kinderstar vermarktet. Sie tourte mit anderen deutschen Schlagerstars durch die Bundesrepublik und trat auch in Wien auf.
Dieser aufregende Lebensabschnitt dauerte bis in die späten 1950er-Jahre an. Irgendwann überwog für Marie Nejar aber das Bewusstsein, dass sie sich nicht mehr für die teilweise rassistischen Liedtexte und ihre Rolle als Kinderstar, geprägt von kolonialistischen Stereotypen, hergeben will. Wie in der NS-Zeit wurde sie auch in ihrer Musikkarriere in Rollen gezwängt, die nicht sie als Person, sondern ihre Hautfarbe und ihre Ethnizität auf diskriminierende Weise in den Vordergrund rückten.
Von der Bühne ans Krankenbett
Sie zog sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurück und arbeitete bis zur ihrer Rente als Krankenschwester am Universitätsklinik Eppendorf. Besonders gefallen habe Marie dabei der menschliche Kontakt und das Vertrauen, das Patient*innen ihr entgegengebracht hätten, berichtet Nigel Asher. Der Hamburger Musiker und Musikproduzent lernte sie einige Jahrzehnte später kennen, sie wurden Freunde.
In den 2000ern erschien Marie Nejars Biografie „Mach nicht so traurige Augen, weil du ein N******** bist: meine Jugend im Dritten Reich“. Sie beteiligte sich in dieser Zeit durch Interviews, Dokumentationsbeiträge und Lesungen am gesellschaftlichen und politischen Diskurs. Dennoch sei sie eher zurückhaltend gewesen, so Nigel Asher. Sie habe nie großes Aufheben um sich und ihre Person machen wollen.
Gleichzeitig sei sie eine wehrhafte Persönlichkeit gewesen – in den letzten Jahren zunehmend besorgt. Darüber, wie sich die Gesellschaft und das politische Geschehen entwickeln. Rassismus ist nie verschwunden und werde immer bleiben – davon sei sie überzeugt gewesen, so Asher.
Schicksale und Biografien sichtbar machen
Spätestens nach Veröffentlichung ihres Buches suchte Marie Nejar stärker den Kontakt zur afrodeutschen Community und knüpfte in den 2000ern enge Bande mit der ISD. Sie sprach bei Vorträgen, in Interviews und für einen TV-Beitrag über ihre Geschichte. Ein Sinneswandel, schließlich wollte Marie Nejar – nachdem sie ins Rampenlicht gezerrt worden war – nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen. Sie wollte „nicht auffallen, nicht anecken und nichts machen, was Klischees entspricht“, sagt ISD-Sprecher Della.
Kritischer Blick auf sich selbst und die Gesellschaft
Della erlebte Marie Nejar in den letzten Jahren ihres Lebens als „aufmerksame Beobachterin“ der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung in der Bundesrepublik. Er attestiert ihr einen „klaren Blick“ – speziell bezogen auf die Nachkriegsgesellschaft, in der noch viele ehemalige NS-Akteure, teilweise sogar in Führungspositionen, präsent waren. Außerdem habe Marie auch ihr eigenes Lebenswerk kritisch reflektiert.
Marie hat sich – allen Anfeindungen zum Trotz – nie das Deutschsein absprechen lassen. Auch nicht, als sie nach dem Krieg nur noch über die französische Staatsangehörigkeit verfügte. Sie wandte sich nie von ihrem geliebten Hamburg ab.
Bis ins hohe Alter aktiv
Die private Marie Nejar beschreibt Nigel Asher noch im hohen Alter als sportlich mit besonderer Begeisterung für Tanzen und Schlittschuhlaufen. Letzteres hat sie im Winter gerne in Planten und Bloomen gemacht, auch noch mit 79 Jahren. Marie Nejar pflegte den Garten der Frauen, einer Gedenkstätte auf dem Friedhof Ohlsdorf. Zuletzt lebte sie im Altersheim, bevor sie am 11. Mai 2025 mit 95 Jahren verstarb. Ihre letzte Ruhe fand sie im Garten der Frauen.
Nigel Asher und die ISD möchten einen Stolperstein für Marie Nejar anlegen und eine Straße nach ihr benennen. Und sie möchten ihre Botschaft lebendig halten: Niemand sollte sich das Deutschsein absprechen lassen und niemand sollte sich sagen lassen müssen, er oder sie gehöre nicht zur Gesellschaft dazu.