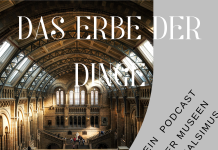Die ehemalige Sammlung „Islamische Kunst“ des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg bekommt einen neuen Namen: „Inspiration SWANA – Perspektiven aus Südwestasien und Nordafrika“. Damit reflektiert das Museum seine koloniale Vergangenheit und rückt regionale Perspektiven in den Vordergrund.
Das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G) hat am vergangenen Donnerstag die neue Sammlungspräsentation „Inspiration SWANA – Perspektiven aus Südwestasien und Nordafrika“ eröffnet. Die Ausstellung ersetzt die bisherige Sammlung „Islamische Kunst“.
Der Begriff SWANA steht für South West Asia and North Africa. Die Bezeichnung ist noch relativ neu und betont geografische und kulturelle Perspektiven. Im Unterschied zu Begriffen wie Naher Osten beschreibt SWANA die Region nicht aus einer europäischen Sicht, sondern neutraler und noch dazu ohne religiöse Bezüge.
Die Kuratorinnen Wiebke Schrape und Jasmin Holtkötter verstehen die Umbenennung der Sammlung als Schritt, veraltete Perspektiven zu überwinden und neue Zugänge zu der Region, Kultur und den Sammlungsobjekten zu schaffen. Zugleich sei dieser Wandel auch ein Anliegen vieler Menschen aus der Region South West Asia and North Africa gewesen und jener, die familiäre oder kulturelle Wurzeln dort haben: „Islamische Kunst hat für viele nicht funktioniert. SWANA öffnet neue Räume und legt eurozentrische Kategorien ab“, erklärt Schrape. Die Region sei nicht ausschließlich über den Islam zu definieren.
Offener Umgang mit der Vergangenheit
Die Sammlung geht auf den Gründungsdirektor Justus Brinckmann zurück, der ab 1873 Objekte aus der SWANA Region erwarb. Das Interesse an den Werken hing eng mit Europas kolonialer und wirtschaftlicher Ausbreitung zusammen. Ob und wie viele der rund 1000 Objekte dabei rechtmäßig erworben wurden oder Raubkunst sind, lässt sich laut den Kuratorinnen nicht sagen.
Kuratorin Schrape erklärt, dass das Museum zwar bereits aktiv Objekte an Herkunftsländer zurückzugeben würde, dies alleine jedoch nicht die Strukturen, aus denen die Ungerechtigkeiten entstanden sind, ändern würde: „Wir können die Geschichte nicht ungeschehen machen. Was wir tun können, ist, sie sichtbar zu machen, an das Unrecht zu erinnern und neue Wege zu legen, damit sich die Situation verbessert. Deswegen auch dieser konsequente Abschluss der historischen Sammlung.“
Die Neupräsentation “Inspiration SWANA” markiert nach “Inspiration Japan” (2023) und “Inspiration China” (2024) den Abschluss der Umgestaltungsphase. Der Fokus liegt darauf, zeitgenössische Kunst einzuzbinden und gemeinsam mit historischen Objekten zu präsentieren. Diese Haltung prägt den Umbauprozess der außereuropäischen Sammlungen im MK&G.
Mehr Transparenz für Herkunft der Sammlung
Die Sammlung gestaltet die Herkunft der Objekte transparent. Kleine orangefarbene Dreiecke markieren einige Objekte, deren Herkunftsgeschichte aufgearbeitet wurde. Diese Objekte sind mit Hinweisen versehen, die zeigen, wie sie oft im Kontext von Kolonialismus und Imperialismus ihren Weg nach Hamburg fanden.
Doch aus welchen Ländern stammt die Kunst eigentlich? Schrape erklärt, dass sich unter den Objekten auch welche aus Regionen befinden, die nie direkt unter europäischer Kolonialherrschaft standen. Auch dort gab es jedoch ungleiche Beziehungen, etwa durch wirtschaftliche Abhängigkeiten. Ein Beispiel von Schrape ist der Iran: Durch enge Verbindungen zu europäischen Unternehmen wie Siemens gelangten zahlreiche Objekte von dort in europäische Sammlungen, sagt sie.

Ziel ist es, künstlerische und kulturelle Ausdrucksformen der SWANA-Region aus heutiger Perspektive neu zu betrachten und weiterzuentwickeln. In acht Themenbereichen, darunter Schrift, Poesie, Geometrie und Spiritualität, soll so erklärt werden, wie Tradition und Gegenwart miteinander verbunden sind.
Kunst gegen Vorurteile
„Es geht nicht nur um Objekte, sondern auch um Menschen, um Begegnungen, Austausch und Fürsorge“, erklärt Kuratorin Holtkötter. So arbeitet das Museum mit zeitgenössischen Künstler*innen aus der Region oder Künstler*innen zusammen, die dort ihre Wurzeln haben.
Imad El Rayess, der gemeinsam mit Jessica Rees das Künstler*innen-Duo Habibi bildet und dessen Familie aus der Region stammt, sieht Ausstellungen wie diese als wichtige Plattform, um Perspektiven zu hinterfragen und auszutauschen. Teil des Projekts des Duos ist ein Banner mit der arabischen Aufschrift „Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Habibi.“ Dabei wurden die Worte Buchstabe für Buchstabe übersetzt und ergeben keine zusammenhängenden arabischen Wörter. In Deutschland würde arabische Schrift oft stigmatisiert, erklärt das Duo. Mit dem Banner will das Duo Habibi ein Zeichen für Offenheit und Dialog setzen und sie als selbstverständlichen Teil des Stadtbilds zeigen.
Ein Raum für den Austausch
Die Ausstellung soll auch einen Raum für Begegnung und Diskussionen schaffen. Diese seien laut Rees in Zeiten von sozialen Medien selten geworden. Sie glaubt, dass solche Ausstellungen es ermöglichen würden in den Dialog zu treten: „Heutzutage passiert das viel zu selten. Man hat oft das Gefühl, wir kommen nur noch über Social Media zusammen, aber das ist sehr limitiert. Genau deshalb sind solche physischen Ausstellungen unglaublich wichtig.” Dabei sei es völlig in Ordnung, wenn Besucher*innen andere Meinungen hätten. Entscheidend sei, dass eine gemeinsame Plattform für Austausch und Diskussion entstehe.
Geöffnet ist das Museum dienstags und mittwochs sowie freitags bis sonntags von 10:00 bis 18:00 Uhr, donnerstags von 10:00 bis 21:00 Uhr.
Vivian Maxim Calderon, Jahrgang 1998, wollte als Kind Filmregisseur werden. Seine Ausrüstung damals: eine Spielzeugkamera. Mittlerweile ist er professioneller unterwegs. Er erstellte bereits ein Imagevideo für eine NGO in Kenia, berichtete über den Kult der Santa Muerte in Mexiko und arbeitete als Clubfotograf in Hamburg. Aufgewachsen in Bielefeld, studierte er Ethnologie an der Universität Hamburg. Bei der “Hamburger Morgenpost” schrieb er über steigende Dönerpreise, Mobilität und Cannabis Social Clubs. Sein Fokus liegt aber auf sozio-kulturellen Perspektiven, die gesellschaftlich oft untergehen. Kürzel: viv