Seit 2019 herrscht Krieg im Sudan. Menschenrechtsorganisationen sprechen von einer der größten humanitären Krisen weltweit – doch kaum jemand nimmt davon Notiz. Der Hamburger Mohamed will das ändern.
Am Tag nach seiner Flucht aus der Ukraine steht Mohamed am Hamburger Jungfernstieg. Um ihn herum wehen blau-gelbe Fahnen, auf der Bühne sprechen Aktivist*innen über die Lage in der Ukraine, nachdem das Land von Russland angegriffen wurde. Rund 30.000 Menschen zeigen ihre Solidarität. Ihre Solidarität für Menschen wie ihn, die aus der Ukraine nach Hamburg geflüchtet sind.
Für Mohamed war die Flucht aus der Ukraine nicht das erste Mal, dass er ein Land wegen eines Krieges verlassen musste. Er stammt aus dem Sudan. Während viele über den Krieg in der Ukraine gut informiert sind, merkte er, dass über die Krise in seinem Heimatland kaum gesprochen wird. Viele seiner Mitbürger*innen in Hamburg wüssten nicht einmal, was dort passiert, obwohl im Sudan eine der schlimmsten humanitären Katastrophen weltweit stattfindet, so Mohamed.
Kindheit zwischen Sudan und Katar
Mohameds Geschichte beginnt in der Al-Jazeera-Region. Sein letzter Besuch dorthin liegt lange zurück. Aber er erinnert sich noch gut an die „grünen Landschaften, soweit das Auge reicht“. Bereits mit sechs Jahren verließ er das Land gemeinsam mit seiner Familie und zog nach Katar. Jeden Sommer verbrachte die Familie aber in seiner Heimat Sudan, wodurch er sie kennen und lieben lernte. „Es gibt viele Tiere und die Landschaft ist grün. Besonders beeindruckt mich, wie solidarisch die Menschen sind: Wenn jemand Hilfe braucht, wissen alle Bescheid und kommen. Das passiert ganz von selbst, ganz ohne Social Media – die Leute wissen es einfach. Das ist etwas, das ich bisher nur im Sudan gesehen habe“, sagt er.
Schon in Mohameds Kindheit war die Situation im Sudan sehr schwierig, wie er berichtet. Er lebte in Khartum, einer Stadt, die stark vom Konflikt zwischen Nord- und Südsudan geprägt war. Bewaffnete Gruppen kämpften gegeneinander und die Versorgung mit Elektrizität, Wasser und Lebensmitteln war häufig unzuverlässig. Zu dieser Zeit herrschte Diktator Omar al-Bashir über das Land. Mohameds Vater ging 2004 nach Katar, um dort zu arbeiten, die restlichen Familienmitglieder folgten zwei Jahre später.
Der Wunsch, eines Tages helfen zu können, brachte Mohamed dazu, Medizin zu studieren. Am liebsten in Europa, was sich zunächst als schwierig herausstellte. Für ein Medizinstudium in Deutschland benötigte er ein C1-Niveau in Deutsch sowie ausreichende finanzielle Rücklagen. Nach mehreren gescheiterten Visabewerbungen gab ein Freund ihm den Tipp, sich für ein Studium in der Ukraine zu bewerben. Er bekam dort ein Visum und zog 2018 für sein Studium in die Stadt Charkiw. Dort studierte er zwei Jahre, bevor er nach Odessa zog, um dort weitere zwei Jahre zu studieren. Rückblickend sagt er: „Es war eine der besten Zeiten meines Lebens. Ich habe dort nur Liebe erlebt.“ Odessa vergleicht er mit Hamburg: „Die sagen dort auch, das ist unsere Perle.“
Flucht aus der Ukraine
Mit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Jahr 2022 veränderte sich Mohameds Leben erneut. Er verließ seine neue Heimat und sein Studium und überquerte die polnische Grenze. Die Flucht war eine „sehr harte Zeit“, so Mohamed. In den Flüchtlingslagern in Polen bemerkte Mohamed zum ersten Mal, dass er anders behandelt wurde als weiße Flüchtlinge.
„Als es nach Deutschland ging, dachten wir: ‚Jetzt geht das Leben weiter, wir sind an einem besseren Ort – in der ersten Welt: Europa. Doch dann sahen wir, wie die ‚erste Welt’ in echt aussieht. Wir lernten, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Menschen aus der ersten Welt und uns aus der dritten Welt. Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß. Meine erste Lektion hier war, was Rassismus wirklich bedeutet. Vorher hatte ich das nicht erlebt. Ich bemerkte auch stark, wie unterschiedlich wir und die ukrainischen Flüchtlinge behandelt wurden“, so Mohamed.
„Wo ist das Auto? Ich komme mit!“
In einem Lager für Geflüchtete in Polen begegnete er Anna, einer Schwarzen Frau aus Hamburg, die gemeinsam mit ihrem Verein insbesondere nicht-weiße Flüchtlinge aus der Ukraine unterstütze. Mohamed erinnert sich: „Sie sagte: ‚Hey, we came to save you from here, come with us!‘“ Sie erklärte, dass sie ihn nach Deutschland, nach Hamburg, bringen würde. „Ich hab einfach gefragt: ‚Wo ist das Auto? Ich komme mit!‘“
Mit einem Bus fuhren sie über Warschau nach Hamburg. Am 3. März 2022 kam Mohamed im Dock Europe e.V., einem gemeinnützigen Internationalen Bildungszentrum in Hamburg-Altona, an. Die Unterstützung und Solidarität, die er in Hamburg erlebte, beeindruckte ihn, und er schloss die Stadt direkt in sein Herz: „Egal wo: Es gibt immer solidarische Menschen. Und egal was passiert: Hamburg bleibt meine Perle“, sagt er.
Der ignorierte Krieg
Mohamed war nun in Sicherheit. Das gab ihm die Möglichkeit, wieder über seinen Ursprung nachzudenken. Denn während der Krieg in der Ukraine weltweit Aufmerksamkeit erhielt, sprachen die Menschen in seinem neuen Umfeld und auch die Medien nie über die Krise im Sudan. Obwohl der Konflikt seit über 920 Tagen andauert.
Der aktuelle Krieg im Sudan begann, wie der Deutschlandfunk und “Die Zeit” berichten, 2019 mit der Entmachtung des langjährigen Diktators Omar al-Baschir. Damals forderte eine zivile Protestbewegung eine demokratische Regierung. Stattdessen rissen zwei bewaffnete Akteure die Macht an sich: die sudanesische Armee (SAF) und die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF). Da beide Gruppen Anspruch auf die politische Kontrolle erhoben, kam es zu einem Konflikt. Beide Seiten erhalten bis heute Unterstützung durch internationale Akteure.
Im gesamten Land kommt es zu Kriegsverbrechen. Die aktuelle Eskalation im Konflikt wurde im Oktober 2025 sichtbar, als, wie “Die Zeit” berichtet, die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) die Stadt Al‑Faschir, die letzte größere Stadt in Darfur, einnahmen.
„Viele müssen sterben, damit wenige reicher werden“
Wenn wir über den Krieg im Sudan sprechen, wird aus Mohameds Sicht ein entscheidender Faktor meist zu wenig diskutiert: „Es geht letztendlich darum, die Ressourcen des Landes zu verteilen und sich daran zu bereichern. Viele müssen sterben, damit wenige reicher werden“, sagt er. Laut der Nachrichtenagentur Al Jazeera verfügt der Sudan über bedeutende natürliche Ressourcen wie Öl, Gold sowie landwirtschaftliche Produkte. Diese Ressourcen sind nicht nur wirtschaftlich wertvoll, sondern werden im aktuellen Krieg auch strategisch umkämpft. Deutschland und andere Industrieländer importieren Teile dieser Rohstoffe, etwa Öl und Agrarprodukte.
Nicht nur ein Bürgerkrieg
In europäischen Medien liest Mohamed meist von einem „Bürgerkrieg“. Ein Begriff, den er ablehnt. Er suggeriere, dass es ein kleiner Konflikt innerhalb des Landes sei. Das stimme nicht. Viele internationale Akteure seien am Krieg beteiligt, so Mohamed. Waffen kämen über Drittstaaten aus Ländern wie Russland, Frankreich und Deutschland, Ressourcen würden geraubt und global verteilt, und die kämpfenden Parteien seien größtenteils ausländisch oder durch ausländische Gelder finanziert.
In der Berichterstattung wird die internationale Tragweite des Konflikts nicht sichtbar – zu dem Schluss kommt eine Analyse der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Demnach trage die Einordnung als „Bürgerkrieg“ dazu bei, die komplexeren, internationalen und geopolitischen Dimensionen der Gewalt auszublenden.
Deutschlandfunk berichtet in einem Artikel im November 2025, dass sowohl die sudanesische Armee als auch die RSF wohl nur durch Unterstützung aus dem Ausland so brutal vorgehen können, wie zu beobachten ist. Auch „Der Spiegel“ schreibt, dass beide Kriegsparteien einander der Unterstützung aus dem Ausland beschuldigen. So stünden Ägypten, die Türkei, der Iran und Russland auf der Seite der sudanesischen Armee. Auf der Seite der RSF sammelten sich demnach die Vereinigten Arabischen Emirate, Libyen, der Tschad und Kenia.
„Wir sind alle Afrikaner“
Häufig werde der Konflikt auch als Konflikt zwischen arabischen und afrikanischen Bevölkerungsgruppen beschrieben. Auch hier interveniert Mohamed: „Wir sind alle Afrikaner. Im Sudan wird zwar zu einem großen Teil arabisch gesprochen, aber es ist auch ein Land mit Hunderten Sprachen und Ethnien.“ Diese Einteilung der Gruppen sei ein Relikt des Kolonialismus und werde im Krieg als Vorwand genutzt, um Ressourcen zu stehlen.
Im Sudan werde Mohamed zufolge nicht zwischen Schwarz und Weiß oder arabisch und nicht-arabisch unterschieden. Die Menschen würden lange ohne Rassismus zusammenleben. Seiner Ansicht nach werden diese Konstrukte im Krieg, durch politische Eliten, regionale Führer*innen und bewaffnete Akteure, genutzt, um Hass zu schüren und Ressourcen zu kontrollieren. Dies bestätigt auch eine Analyse von Justin Willis, Professor für Geschichte an der Durham University, und Willow Berridge, Dozentin für Geschichte an der Newcastle University. Willis zeigt auf, dass vereinfachende Kategorien bewusst eingesetzt werden, um Macht und Ressourcen zu legitimieren.
„Immer schwieriger nachzuvollziehen, warum wer kämpft“
Die Anti-Rassismus-Expert*innen der Vereinten Nationen äußern in einer Pressemitteilung des Ausschusses zur Beseitigung der Rassendiskriminierung ernste Bedenken über den zunehmenden Gebrauch entmenschlichender Sprache sowie von Hassrede. Auch ethnisch motivierte Menschenrechtsverletzungen und -missbrauch sind Themen. Besonders betroffen seien Angehörige der ethnischen Gemeinschaften der Fur, Masalit und Zaghawa. Diese Taten seien von den Rapid Support Forces (RSF) und verbündeten Kräften in El Fasher in Nord-Darfur begangen worden.
Mohamed widerspricht Vorstellung, es handele sich um einen rein inner-sudanesischen Konflikt. Viele der Milizen, die an Massakern beteiligt seien, stammten nicht aus den betroffenen Regionen, erklärt er. Finanziert würden sie von außen, ihr Ziel sei der Zugriff auf die Ressourcen des Landes. Die Milizen drängen in Dörfer ein, bewaffnen Zivilisten, schüren gezielt Angst und Hass und nutzen bestehende Spannungen zwischen Gemeinschaften aus. Stammeskonflikte würden instrumentalisiert, um Menschen für fremde Interessen kämpfen zu lassen. „Es wird immer schwieriger nachzuvollziehen, wer warum kämpft“, sagt Mohamed. Auch Jugendliche und Kinder würden rekrutiert.
Egoistische Ziele
Dr. Gerrit Kurtz ist Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Er thematisiert in einer Publikation, die im Juli 2025 veröffentlicht wurde, den Schutz der Zivilbevölkerung im Sudan: „Die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung geht nicht nur von den RSF und den SAF aus”, so Kurtz. „Hatte der Krieg als Krieg zwischen diesen Militäreinheiten begonnen, hat er sich mittlerweile auf Teile der Gesellschaft ausgebreitet.“ Beide Seiten würden ethnisch konnotierte Rhetorik zur Mobilisierung und Rekrutierung verwenden. „Einheiten werden auf tribaler Basis angeworben; sie sehen den Kampf teilweise als Gelegenheit, ihre jeweils eigenen Ziele gegenüber verfeindeten Gruppen umzusetzen“, so Kurtz weiter. Er bezieht sich bei diesem Punkt auf ein Essay des Autors Joshua Craze, das in der britischen Zeitschrift „New Left Review“ erschien.

Für Mohamed steht der Krieg im direkten Gegensatz zu den Protesten von 2019. Damals sei es der Wunsch nach einer friedlichen, zivilen Regierung gewesen, der Millionen Menschen auf die Straße gebracht habe. Er bezeichnet die Revolution als die „schönste und größte“, die das Land je erlebt habe, und als Hoffnung, die bis heute nicht verschwunden sei.
„Talk About Sudan“
Bewegt von der Solidarität, die ihm bei seiner Ankunft begegnete, entschied sich Mohamed, selbst aktiv zu werden. Weil kaum jemand über die Situation in seinem Heimatland sprach, nahm er es selbst in die Hand. Nach dem Motto „Don’t wait for the leader, do it alone“ organisierte er eine erste Kundgebung. „Ich hatte eigentlich nicht mehr geplant, aber die Leute fragten, wie es weitergeht“, erzählt er. Die positive Resonanz motivierte ihn, weitere Veranstaltungen zu organisieren. Schritt für Schritt wuchs daraus das Format „Talk About Sudan“. Gemeinsam mit anderen Menschen aus dem Sudan tat er sich zusammen.
Ziel des Vereins ist es mit Infoveranstaltungen, Demonstrationen, Themenabenden und weiteren Aktionen mehr über die Situation im Land aufzuklären und Spenden für die Menschen im Land zu sammeln. Der Verein steht nun kurz davor, als gemeinnütziger Verein angemeldet zu werden. Hierzu fehlen laut Mohamed nur noch wenige formale Schritte.
Was ihm Hoffnung gibt
Die Arbeit für „Talk About Sudan“ gibt Mohamed Hoffnung. Auch, wenn sein Alltag als Geflüchteter in Deutschland nicht immer leicht ist und er sein Studium der Medizin in Deutschland nicht weiterführen konnte. Besonders motiviert ihn zu sehen, wie die Menschen im Sudan trotz allem durchhalten und dass die gesammelten Spenden tatsächlich ankommen. Das Team schickt Geld, Lebensmittel und Medikamente ins Land und hat verlässliche Kontakte, über die die Hilfe sicher weitergegeben wird. „Für uns mag es nur eine kleine Spende sein, doch eine Person kann einen Unterschied machen. Dort bedeutet es oft den Unterschied zwischen Leben und Tod.“
Stabile Solidarität statt Social-Media-Trend
Als Mohamed 2022 in Deutschland ankam, fehlte ihm die Sichtbarkeit für sein Heimatland, also nahm er es selbst in die Hand, den Sudan sichtbar zu machen. Heute erlebt er eine wachsende Verbundenheit, vor allem in den sozialen Medien: Viele Menschen teilen Informationen über den Sudan, zeigen Unterstützung und machen auf die humanitäre Lage aufmerksam. Mohamed appelliert an die deutsche Öffentlichkeit, sich tiefergehend zu informieren und auch internationale Medien zu verfolgen. Mit „Talk About Sudan“ möchte er selbst zu mehr Aufklärung beitragen: „Ihr könnt uns auf Instagram folgen. Dort teilen wir Informationen und erklären, was im Sudan passiert.“
Mohamed hofft, dass diese Solidarität nicht nur ein kurzfristiger Trend bleibt, sondern sich auch auf der Straße zeigt. So wie bei der Demonstration für die Ukraine, die er an seinem zweiten Tag in Deutschland erlebte. Denn genau diese sichtbare Anteilnahme gibt ihm die Kraft, weiterzumachen.


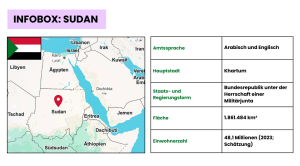






![Hamburg prüft Ein Demoschild mit der Aufschrift: Recht[s]zeitig Prüfen. Jetzt.](https://fink.hamburg/wp/wp-content/uploads/2026/01/IMG_8743-2-218x150.jpg)

