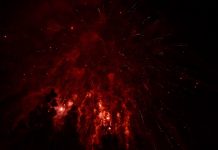Glutamat, Hefeextrakt oder E620: Was verbirgt sich hinter den Inhaltsangaben auf unseren Lebensmitteln? Das Deutsche Zusatzstoffmuseum in Hamburg zeigt, was in unserem Essen steckt – und was besser ins Museum gehört.
Von Fertigpizzen, veganen Salami-Alternativen bis zum Fruchtjoghurt: Der Raum erinnert an einen Supermarkt. Ein Blick nach oben. Sonnenlicht hinter einer Fensterverglasung und weiße LEDs. Eine Besucherin scannt den Strichcode einer Tiefkühlpizza an einer Expresskasse. “Pieeep”, “piep”, der rote Laser erfasst den Code. Doch anstelle des Artikelnamens und des dazugehörigen Preises erscheint eine Liste von E-Nummern.
Zwei andere Besucher*innen stehen an einem Tisch, der mit einer Vielzahl an Aromen in kleinen Fläschchen gedeckt ist. Wie riecht eigentlich Spinat? Und wie ein Parmesan-Bacon-Aroma? Die Besucher*innen rümpfen ihre Nasen, als sie an den Aromen schnuppern – im Deutschen Zusatzstoffmuseum Hamburg.
Vergrößern

Nicht belehren, aber aufklären
Stabilisatoren, Emulgatoren und modifizierte Stärke, seit 2008 will das Deutsche Zusatzstoffmuseum Hamburg bei den E-Nummern Durchblick verschaffen. Das einem Supermarkt nachempfundene Museum zeigt, welche Zutaten sich hinter der Inhaltsangabe von Produkten verbergen. E-Nummern sind Kurzbezeichnungen für in der Europäischen Union zugelassene Lebensmittelzusatzstoffe. Sie kennzeichnen diese und sollen der Transparenz für Verbraucher*innen dienen.
„Es ist nicht die Idee der Ausstellung,
mit erhobenem Zeigefinger zu sagen:
Das und das darf man essen und das nicht.“
Für die Konsumierenden ist es dennoch oft unklar, was eigentlich im Essen steckt und was sich hinter den Nummern oder sehr chemisch klingenden Namen verbirgt: E210 oder Benzoesäure, E243 oder Ethyllaurylarginat – was ist das eigentlich genau?
Eine Frau und drei Männer groß ist die Besuchsgruppe heute, zu der Christian Niemeyer spricht. Er ist Diplom-Biologe und Leiter des Deutschen Zusatzstoffmuseums Hamburg. Niemeyer trägt ein blau-weiß kariertes Hemd und seine braunen, kurzen Haare sind zu einem Seitenscheitel gekämmt. Seine Stimme ist leise, er wählt seine Worte mit Bedacht.
„Es ist nicht die Idee der Ausstellung, mit erhobenem Zeigefinger zu sagen: Das und das darf man essen und das nicht“, sagt Niemeyer. „Es geht vielmehr darum, ein Bewusstsein dafür zu erzielen, was im Essen steckt und wieso ein Stoff zur Produktion verwendet wird.“ Das auf dem Großmarkt Hamburg angesiedelte Museum will vor allem Schulklassen, aber auch alle interessierten Verbraucher*innen erreichen, so der Museumsleiter.
Vergrößern

Der Bierbank-Test: Zusatzstoffe haben eine lange Geschichte
Die Besucher*innen laufen einen Gang entlang, dessen Wand mit verschiedenen Ereignissen der Zusatzstoff-Historie geschmückt ist. Was gab es früher? Ein Bild zeigt, wie der Malzgehalt im Bier überprüft wurde: Männer in Lederhosen setzten sich auf eine in Bier getränkte Holzbank. Sie verweilten so lange auf der Bank, bis das im Bier enthaltene Wasser gänzlich verdunstete. Der Malzgehalt stimmte, wenn die Holzbank beim Versuch aufzustehen noch an den Lederhosen klebte.
Eine Vitrine, die fast die ganze Wand einnimmt, ist gefüllt mit Fläschchen und Gefäßen mit einem roten oder blauen Schraubverschluss aus Kunststoff. Es sind die Zusatzstoffe, die sich hinter den E-Nummern verbergen. Manche Stoffe sind feine bunte Pulver, wie das orangene E100 Kurkumin, viele sind weiße Pulver, die mal feiner oder grobkörniger sind. Andere lagern als Flüssigkeiten in Flaschen, wie die farblose E338 Phosphorsäure.
Zusatzstoffe sind in verschiedenen Klassen im E-Nummern-System geordnet. Der Farbstoff Kurkumin hat die Nummer E110 und wird zum Anfärben von orangenen oder gelben Lebensmitteln wie Margarine oder Senf verwendet. Andere Stoffklassen wie Emulgatoren, Süßstoffe oder Verdickungsmittel reihen sich in die rund 320 E-Nummern lange Liste ein. Ebenso ist auch das große Zusatzstoff-Regal im Museum geordnet: Im obersten Regalfach befinden sich die Farbstoffe, gefolgt von den Konservierungsstoffen im nächsttieferen Fach. Im untersten Fach sind die Säuerungsmittel: E338 Phosphorsäure befindet sich beispielsweise in Käse oder Cola.
Natürlich ist gut und künstlich ist schlecht?
„Da sind die Gifte!“, flüstert eine Besucherin ihrem Partner zu, während die Gruppe auf das große Zusatzstoff-Regal blickt. Aber ist das wirklich so?
Zusatzstoffe sind teilweise künstlich hergestellt, teils natürlichen Ursprungs. Ein Beispiel: das Vanillin aus der Vanilleschote. Der Stoff Vanillin ist hauptverantwortlich für das Vanillearoma und von Natur aus in der Vanilleschote enthalten. Es kann entweder direkt aus der Schote extrahiert oder synthetisch und günstig aus dem Aroma Eugenol hergestellt werden.
Und bei der Vanille ist es sogar noch komplizierter: „Natürliches Vanillearoma“ etwa muss zu mindestens 95 Prozent aus der Vanille stammen, „natürliches Aroma“ muss gar nicht aus der Vanille stammen – sondern nur aus Naturstoffen und hinter „Vanillearoma“ verbirgt sich meist künstliches Vanillin. Der weltweite Bedarf an Vanillearoma könnte ohne künstliches Vanillin nicht gedeckt werden. Für Verbraucher*innen ist all das oft nur schwer zu durchschauen.
Infokasten
Wer ist die Efsa?
Die European Food Safety Authority, kurz Efsa,
ist die Europäische Behörde für LebensmittelsicherheitWas macht die Efsa?
Sie führt unter anderem Risikobewertungen von Lebensmittel-
zusatzstoffen gemäß der
Europäischen Kommission durch.
Nicht zuletzt können natürliche Substanzen genauso schädlich oder giftig sein wie synthetisch hergestellte. Wie ein Stoff hergestellt wird oder wo er vorkommt, ist kein Indiz dafür, ob er gesundheitsschädlich oder gar giftig ist. Die schwarze Tollkirsche etwa ist eine natürliche vorkommende Beere. „Tollkirschen-Salat essen Sie trotzdem nicht“, sagt Niemeyer. Denn der ist zwar natürlich – aber giftig.
Museumsleiter Niemeyer beginnt über die Vorteile von E-Nummern zu sprechen. „Erst als man 1960 anfing, die Stoffe zu klassifizieren und sie als E-Nummern zu listen, konnte man beginnen, sie einheitlich zu untersuchen“, sagt er. In der EU ist die Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) dafür zuständig, die Zusatzstoffe einheitlich zu bewerten (siehe Infokasten).
So trickst die Industrie mit Zusatzstoffen
Niemeyer geht ein paar Schritte weiter entlang der Supermarktregale. Er stoppt am Ende der Wand und hält die Verpackung eines veganen Salami-Ersatzes hoch auf der „frei von künstlichen Zusatzstoffen steht“. Klingt gut. „Ist das so?“, fragt eine Besucherin. Um die Frage zu beantworten, holt Niemeyer aus.
Problematisch sei, dass Verbraucher*innen heute eher abgeschreckt von E-Nummern sind und diese nicht mehr in ihren Produkten haben wollen. „Stattdessen bekommen sie schönere Begriffe, hinter denen eventuell wieder E-Nummern stecken“, sagt der Museumsleiter. Einer dieser „schöneren Begriffe“ sei das sogenannte funktionale Additiv. „Funktionale Additive sind aus meiner Sicht Zusatzstoff-Ersatzstoffe“, erklärt Niemeyer.
In Chips beispielsweise ist meist Hefeextrakt zugesetzt. Hefeextrakt ist ein funktionales Additiv, also ein Ersatzstoff, für die E620 Glutaminsäure (Glutamat), denn der Extrakt besteht größtenteils aus Glutamat. Beide, Hefeextrakt und Glutamat, werden als Geschmacksverstärker eingesetzt.
„Weder die Salami fällt
so fertig vom Baum,
noch die vegane Salami.
Beide müssen irgendwie verarbeitet werden.“
Ein Trick der Industrie also: Als würde man das verpönte Glutamat in eine hübsche Schachtel legen mit der Aufschrift „Hefeextrakt“. Die Funktion bleibt dieselbe, aber die Verpackung ist für Verbraucher*innen ansprechender. So darf die Industrie den veganen Salami-Ersatz dank des Hefeextraktes als „frei von künstlichen Zusatzstoffen“ ausloben.
Niemeyer ärgert das. Wenn die Industrie bereit wäre zu erklären, wieso welcher Stoff verwendet würde, bräuchte man keine funktionalen Additive, sagt er. „Weder die Salami fällt so fertig vom Baum, noch die vegane Salami. Beide müssen irgendwie verarbeitet werden.“ Dafür bedürfe es transparenter Information. Und was in Lebensmitteln steckt, müsse für die Verbraucher*innen auch ersichtlich sein, so der Museumsleiter.
Wie bewertet die Efsa Lebensmittelzusätze?
Nach spezifischen Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 234/2011 festgelegt sind:
- Aufnahme, Verteilung, Verstoffwechselung und Ausscheidung von Zusatzstoffen
- Toxikologische Studien: Dazu gehören unter anderem Untersuchungen zur chronischen Toxizität, zur Kanzerogenität, also ob ein Stoff krebserzeugend ist, sowie zur Reproduktions- und Entwicklungstoxizität, also ob und wie sich ein Stoff auf die Fortpflanzungsfähigkeit bzw. Fruchtbarkeit und das Wachstum einer Person auswirkt.
- No-Observed-Adverse-Effect-Level (NOAEL): Die höchste Dosis, bei der keine unerwünschten Wirkungen beobachtet werden.
- Acceptable Daily Intake (ADI): Der ADI-Wert wird aus dem NOAEL abgeleitet und gibt die Menge des Zusatzstoffs an, die täglich ein Leben lang ohne gesundheitliche Bedenken aufgenommen werden kann.
- Humanstudien: Wenn verfügbar, werden auch Daten aus Studien mit Menschen berücksichtigt.
Helen Kemmler, Jahrgang 1998, ist schon ein Chlorspeicher in die Luft geflogen. Denn für ihre Masterarbeit in der Gas-Chemie kochte sie vor allem im Labor an der FU Berlin und in Bologna. Durch die Berichterstattung in der Corona-Pandemie fiel der Chemikerin auf: Im Journalismus gibt es zu wenige Naturwissenschaftler*innen. Also verzichtete Helen auf eine Promotion. Stattdessen überquerte sie die Alpen und startete einen Blog über PFAS, Kontrabass und Berge. Außerdem arbeitete sie in einem Outdoor-Geschäft, wo sie unter anderem Klaas Heufer-Umlauf zum Schuhregal führte. Ihr Ziel: Wissenschaftsjournalistin, am liebsten bei Quarks. Kürzel: kem