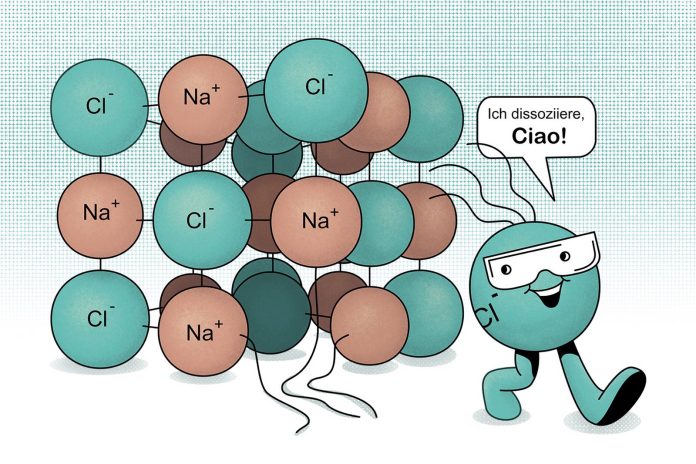
Erwartungen von außen begleiten uns von klein auf. Wie gehen wir damit um, wenn wir die Erwartungen anderer nicht erfüllen? Und weshalb kommen wir dabei selbst oft zu kurz? Damit musste sich FINK.HAMBURG-Redakteurin Helen Kemmler in ihren 20ern auseinandersetzen.
Chemiestudium, Promotion, Job in der Chemieindustrie: die Mainstream-Karriere einer Chemikerin. Viele aus meinem engen Umfeld, darunter meine Eltern und insbesondere mein Vater, selbst promovierter Chemiker, haben diesen Weg von mir erwartet – oder zumindest dachte ich das. Hinzu kommt eine immens hohe Quote von 85 Prozent der Masterand*innen in der Chemie, die eine Promotion anschließen. Das ist gesellschaftlich ein ganz schöner Druck. Vielleicht verständlich, dass mir der Satz: „Ich möchte nicht in der Chemie bleiben!“ während meiner Masterarbeit ziemlich schwerfiel. Mit diesem Entschluss habe ich die Erwartungen anderer in Enttäuschung verwandelt.
“Ich möchte nicht in der Chemie bleiben.”
Erwartungen von außen sind Vorstellungen oder Wünsche, wie etwas oder jemand zu sein hat. Sie begleiten uns von klein auf. Eltern oder Nahestehende sprechen Erwartungen entweder aktiv aus, oder äußern sie durch Reaktionen wie Enttäuschung oder Stolz erst im Nachhinein.
Serie “Aus den 20ern”
FINK.HAMBURG hat Personen unter dreißig befragt, welche Themen sie grade beschäftigen. Diesen Themen wurde jeweils eine Folge der Serie gewidmet – um sie zu diskutieren, Lösungsansätze zu bieten und einen Raum zu kreieren. Ella (23) hat gesagt: “Du hast nur ein Leben und du solltest es leben und das ist schon wichtig.”Die Serie erscheint jeden Donnerstag hier auf FINK.HAMBURG.
Nach dem Konzept des „Wahren und des falschen Selbst“ vom englischen Psychoanalytiker Donald Winnicott bekommen schon Kinder und Babys durch die Eltern mit, was falsch und unerwünscht ist. Die Kinder fangen gegebenenfalls an, sich danach zu richten und passen ihr Verhalten an. Bei zu langanhaltender Anpassung bauen sie ein „falsches Selbst“ auf. Dieses anpassende Verhalten weist einige Parallelen mit dem heutigen Trend-Begriff des „People Pleasers“ auf, wie Psychologe Prof. Dr. Michael Klein auf seinem Portal schreibt.
“Bei zu langanhaltender Anpassung bauen sie
ein “falsches Selbst” auf.”
Ich selbst habe Schwierigkeiten „Nein“ zu sagen und will es immer allen anderen recht machen – ein waschechter „People Pleaser“ also. Vor allem während des Abiturs und meines Bachelors habe ich nicht viel auf mich selbst gehört, sondern mich in den Vorstellungen anderer verrannt. Für Hobbys habe ich mir irgendwann gar keine Zeit mehr genommen, für meine Freundschaften sehr wenig. Nach der Theorie von Winnicott bin ich wohl zu sehr meinem falschen Selbst gefolgt.
Aus dem Alltag gekickt

Erst als mich die Pandemie zu Beginn meines Masterstudiums aus meinem laborgeprägten Alltag gekickt hat, änderte sich das. Das erste Mal seit langer Zeit habe ich mich nicht von Deadline zu Deadline gehangelt, sondern mehr Zeit für Hobbys, Freund*innen und mich selbst gehabt. Ich habe angefangen zu bloggen, mehr zu schreiben und dabei immer mehr den Traum entwickelt, eine Wissenschaftsjournalistin zu werden – um Wissenschaft verständlicher zu machen. Dadurch konnte ich wieder mehr zu mir selbst finden und mich mit meinen Wünschen und Erwartungen auseinandersetzen. Wenn man so will, hat die Pandemie mir in dem Punkt wirklich etwas Positives gebracht.
Das merken auch meine Eltern, Familie und Freund*innen. Es war ziemlich schwer, sich mit Anfang, beziehungsweise Mitte zwanzig einzugestehen, dass ich nicht auf der vorhersehbaren Bahn bleiben möchte. Diesen Beschluss dann anderen mitzuteilen und Erwartungen nicht gerecht werden zu können, war auch nicht unbedingt leichter. Trotzdem war es für mich die beste Entscheidung, mit den Erwartungen zu brechen.
“Dadurch konnte ich wieder mehr zu mir selbst finden und mich mit meinen Wünschen und Erwartungen auseinandersetzen.”
Seitdem geht es mir wesentlich besser. Ich bin deutlich motivierter und dankbar, jetzt da zu sein, wo ich gerade bin. Im Wissenschaftsjournalismus kann ich beide Welten ein Stück weit vereinen: Meine Begeisterung für die Chemie und die Wissenschaft sowie die Kreativität aus dem Journalismus. Ich bin auch ein bisschen stolz, nicht dem Mainstream zu folgen, sondern mein eigenes Ding zu machen.
Am Ende wollen Nahestehende meistens ja auch nur das Beste für einen: glücklich und zufrieden sein. So war es zumindest bei mir.
Mehr Texte "Aus den 20ern":
Helen Kemmler, Jahrgang 1998, ist schon ein Chlorspeicher in die Luft geflogen. Denn für ihre Masterarbeit in der Gas-Chemie kochte sie vor allem im Labor an der FU Berlin und in Bologna. Durch die Berichterstattung in der Corona-Pandemie fiel der Chemikerin auf: Im Journalismus gibt es zu wenige Naturwissenschaftler*innen. Also verzichtete Helen auf eine Promotion. Stattdessen überquerte sie die Alpen und startete einen Blog über PFAS, Kontrabass und Berge. Außerdem arbeitete sie in einem Outdoor-Geschäft, wo sie unter anderem Klaas Heufer-Umlauf zum Schuhregal führte. Ihr Ziel: Wissenschaftsjournalistin, am liebsten bei Quarks. Kürzel: kem








