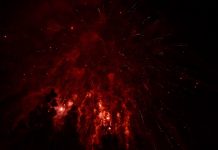E-Roller auf dem Gehweg, keine Lautsprecheransagen im ÖPNV. Für eine sehende Person kein Problem, für blinde Menschen eine Einschränkung. André ist seit seiner Geburt blind. So geht er mit Herausforderungen im Alltag um.
Ein Beitrag von Pauline Claussen, Luna Baumann Dominguez, Louisa Eck und Lara Kitzinger
Früh am Morgen in Hamburg Horn: In einem Wohngebiet, zwischen roten Backsteinhäusern und ruhigen Straßen, steht ein Kind an einer Kreuzung. Schulranzen auf dem Rücken, einen langen Stock in der Hand, nähert es sich der Straße, lauscht, und tritt vorsichtig auf die Fahrbahn. Kurze Zeit später biegt ein Auto in die Straße ein. Das Kind hat den gegenüberliegenden Bordstein noch nicht ganz erreicht, wird vom Auto am Bein erfasst – und fällt.
Der Fahrer steigt aus, begleitet den Jungen auf die andere Straßenseite und setzt ihn auf eine Mauer. Versichert dem Jungen, er sei gleich wieder da. Ein Motor brummt, das Geräusch entfernt sich, Minuten vergehen. Der Junge sitzt auf der Mauer, wartet. Schließlich setzt das Kind seinen Schulweg fort. Der Fahrer ist nicht zurückgekommen.
Als der Junge später nach Hause kommt, erzählt er seinen Eltern vom Unfall zunächst nichts. Zu groß ist die Angst, er hätte etwas falsch gemacht, sich fahrlässig verhalten, dem Auto im Weg gestanden.
Blinde in Deutschland
Dieses Ereignis ist über 40 Jahre her. Heute ist André Rabe 54 Jahre alt, hat mittellange, graubraune Haare und einen Vollbart. Statt eines Schulranzens trägt er einen schwarzen Rucksack. Der Blindenstock ist geblieben. Zwar wurde André bei dem Unfall damals nicht ernsthaft verletzt, trotzdem zeigt dieser die Schwierigkeiten und Gefahren auf, denen Blinde ausgesetzt sind – in einer Öffentlichkeit, die sie nicht mitdenkt.
In Deutschland lebten 2021 rund 334.600 Menschen mit einer Sehbehinderung, etwa 66.200 von ihnen sind vollständig blind. Damit machen Blinde und Menschen mit Sehbehinderung einen Anteil von 0,41 Prozent an der Gesamtbevölkerung in Deutschland aus und sind zahlenmäßig eine sehr kleine Gruppe – ein möglicher Grund, warum ihre Bedürfnisse bei Bemühungen um Barrierefreiheit an einigen Stellen vergessen werden. Aber natürlich keine Entschuldigung.
André ist einer von etwa 1940 Blinden, die in Hamburg leben (Stand 2021). Wir haben ihn auf seinem Weg von der Arbeit nach Hause begleitet und dabei erfahren, wie Barrierefreiheit in der Hamburger Öffentlichkeit umgesetzt wird – und wo sie an ihre Grenzen stößt.
Unterwegs mit André
André ist Telefonist – in den 1990ern einer der am häufigsten gewählten Berufe für Blinde. Er wäre lieber Masseur geworden: „Telefonist zu werden war nie mein Wunsch. Es ergab sich allerdings die Gelegenheit, jemanden bei den Hamburger Energienetzen zu beerben, die in den Ruhestand gegangen ist. Mittlerweile bin ich dort seit über 26 Jahren."
In den letzten 20 Jahren hat sich die Arbeit mit fortschreitender Technologie stark gewandelt. Inzwischen telefoniert er weniger, betreut dafür aber mithilfe von Screenreader und Braillezeile zwei E-Mail-Postfächer. Seine Rolle in eigenen Worten: „der lebende Spamfilter.”
Definitionen Blindheit/Sehbehinderung
Sehbehindert – ist ein Mensch, wenn er selbst auf dem besser sehenden Auge trotz Brille/Kontaktlinsen nicht mehr als 30 Prozent sehen kann.
Hochgradig sehbehindert – ist ein Mensch, wenn er selbst auf dem besser sehenden Auge trotz Brille/Kontaktlinsen nicht mehr als fünf Prozent sehen kann.
Blind – ist ein Mensch, wenn er selbst auf dem besser sehenden Auge trotz Brille/Kontaktlinsen nicht mehr als zwei Prozent sehen kann.
Seit 1989 ist André ehrenamtliches Mitglied im Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg (BSVH). Mittlerweile ist er zweiter Vorsitzende des Vereins und zudem im Leitungsteam des Arbeitskreises Umwelt und Verkehr tätig. Den Posten des zweiten Vorsitzenden habe er angeboten bekommen, nachdem sein Vorgänger eines Tages plötzlich von allen Ämtern zurückgetreten ist. „Ich wollte eigentlich gar nichts groß bewirken und sah mich nie als Vorstandsmitglied oder Ähnliches", so André.
Wir treffen André nach Feierabend am Ausgang seiner Arbeit, vor der Bushaltestelle S Tiefstack.
Barrierefreiheit braucht mehr als nur Aufzüge
Zur Arbeit kommt André mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Erst mit der U-Bahn, dann mit der S-Bahn. Die Strecke kennt er nach über 20 Jahren auswendig. Mit André laufen wir durch den S-Bahnhof. Am Anfang sind wir vorsichtig, nehmen automatisch die Rampe. „Hier hätte ich jetzt die Treppe genommen, nicht die Rampe“, erwähnt André beiläufig. Dass er so einfach mit der Bahn nach Hause findet, ist für viele andere blinde und sehbehinderte Menschen nicht selbstverständlich. Eine Online-Umfrage der Stadt Hamburg hat ergeben: 85 Prozent der blinden Teilnehmenden fühlen sich im ÖPNV beeinträchtigt. Mehr als bei jeder anderen in der Umfrage genannten Behinderung.
Dabei wirbt die Hamburger Hochbahn damit, dass mittlerweile schon 96 Prozent der Haltestellen barrierefrei ausgebaut sind. Zu diesem Ausbau gehören auch tastbare Orientierungshilfen für blinde und sehbehinderte Menschen – Leitstreifen am Boden zum Beispiel, oder Braille-Schrift auf den Geländern zu den Gleisen. Warum ist der ÖPNV trotzdem für so viele blinde und sehbehinderte Personen so eine große Herausforderung?
Die Antwort: „Eigentlich kämpfen wir im Verein seit 20 Jahren für durchgehende akustische Fahrgastinformationen“, erzählt André. „Alles, was am Bahnsteig sein müsste – da ist so gut wie gar nichts.“ Welche Bahn fährt als nächstes ein? Kommt sie pünktlich? Fragen, die sich sehende Menschen mit einem einfachen Blick auf die Anzeige beantworten können. Während bei der S-Bahn mittlerweile kommende Züge angesagt werden, fehlen Audioinformationen bei U-Bahnen und Bussen beinahe komplett.
Was das bedeutet, kann uns André vor Ort zeigen. Als wir mit ihm am Bahnsteig am Berliner Tor stehen, ändert sich die Anzeige plötzlich: Die nächste U2 fährt nur bis Burgstraße, nicht wie geplant bis zur Horner Rennbahn. Wäre André jetzt allein unterwegs, wüsste er erst nach dem Losfahren, dass er mit dieser Bahn nicht bis zu seiner Zielhaltestelle kommt.
Dass blinde und sehbehinderte Personen trotz offiziell barrierefreier Haltestellen Probleme mit dem ÖPNV haben, zeigen die obigen Umfrageergebnisse zu den Änderungswünschen. 91 Prozent der Teilnehmenden wünschen sich bessere Orientierungs-, 70 Prozent bessere Informationsmöglichkeiten. Niemand von ihnen gibt an, nichts ändern zu wollen. Seit der Umfrage 2021 wurden sechs weitere U-Bahn-Haltestellen ausgebaut, auch sie ohne Audiosignale. Auf eine Anfrage antwortet die Hochbahn: „Das Thema ist bei uns auf der Projektliste. Durchsagen stellen aktuell keine Lösung da, da sie 'manuell' aufgesprochen werden müssten. Das ist nur in Einzelfällen darstellbar, nicht als Standardlösung.“
Auch ohne akustische Signale schafft André es mit dem ÖPNV meist durch Hamburg. Mithilfe von Navigations-Apps, anderen Bahnfahrer*innen und ein bisschen Glück. Klar ist aber: Das nimmt Zeit in Anspruch – mehr Zeit, als eine sehende Person im Alltag einplanen muss. Neben erschwerter Navigation am Bahnsteig gibt es Stationen, die André normalerweise komplett vermeidet. Dass er mit uns am Berliner Tor umsteigt, ist eine Ausnahme. Der Weg durch die Baustelle an der S-Bahn-Station ist so schwer zu navigieren, dass André lieber am Hauptbahnhof umsteigt, obwohl er dann pro Strecke fünf Minuten länger fährt.
Barrieren auf Gehwegen
Mittlerweile sind wir aus der Bahn ausgestiegen. André tastet mit seinem Blindenstock und bleibt stehen. Merkt, es steht ein E-Scooter mitten auf dem Gehweg. Nimmt den Roller und räumt ihn zur Seite. „Ich bin hier morgens auch schon mal über einen Roller geflogen, weil der aus einer Hecke herausragte“, sagt er. Für André sind E-Roller eine weitere Barriere – neben Autos und kaputten Bürgersteigen. Selbst ordnungsgemäß abgestellt können sie für Blinde gefährlich werden. Fahrräder hingegen empfindet er als weniger problematisch: „Die eigenen Fahrräder parken die Leute ordentlich, weil sie die wiederfinden wollen. Bei E-Rollern ist das anders. Die stellen sie einfach irgendwo ab, wo es gerade passt.“
Die Stadt Hamburg geht gegen die Probleme mit den E-Scootern vor: Der Landesbetrieb Verkehr und die Polizei erfassen falsch abgestellte E-Roller, stellen diese gegebenenfalls um und leiten Bußgeldverfahren ein. Die Kosten dafür tragen die Nutzenden. Der Deutsche Blinden und Sehbehindertenverband e.V. kritisiert, dass dieses Vorgehen nicht ausreicht. Die Justiziarin des Vereins fordert deutlich markierte Parkflächen für E-Scooter – ähnlich den Bodenleitsystemen mit Rillen – um Gehwege freizuhalten und die Barrieren für blinde und sehbehinderte Menschen zu minimieren.
Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat beschreibt die Roller als „neue Barrieren auf Gehwegen“. Für Blinde wie André ist das spürbar. Sie orientieren sich am inneren Rand des Gehweges – genau dort, wo die Scooter oft geparkt werden.
Hilfsmittel im Alltag: Zwischen Apps, Brailleschrift und Extrakosten
Für blinde und sehbehinderte Menschen sind Hilfsmittel unverzichtbar – ob beim Lesen, Kochen oder unterwegs. Das Smartphone als Multitool hilft André im Alltag sehr. „Ich habe mal nachgezählt – weit über 500 Apps habe ich auf meinem Handy“, sagt er. Das Handy bedient er mit der Voiceover-Funktion, dem mitgelieferten Screenreader von Apple:
Heute gibt es zum Beispiel eine Farberkennungs-App für das Smartphone, die monatlich knapp sechs Euro kostet. Bevor es Smartphones gab, brauchte man dafür ein Gerät, für das man je nach Anbieter etwa 500 Euro zahlt. Der Farberkenner ist ein technisches Hilfsmittel, das blinden oder sehbehinderten Menschen zum Beispiel dabei hilft, farblich passende Kleidung auszuwählen.
Heute vereint das Smartphone viele technische Hilfsmittel, aber nicht alle sind als App möglich. André nutzt zuhause eine Blindenschriftmaschine für Brailleschrift, etwa um Gewürze zu beschriften. So muss er nicht jedes Mal das Handy nutzen, um zu erkennen, welches Gewürz er gerade in der Hand hält: „Das ist zum Beispiel ein wichtiger Grund, warum man Braille können sollte. Dadurch kann man die Sachen beschriften und ohne technische Hilfe sofort lesen. Damit meine ich, ich brauche kein Handy, das zum Beispiel aufgeladen sein muss“.
Lesen in Braille, digital und als Hörbuch

Kochen ist Andrés Leidenschaft und Lesen sein großes Hobby, für das er auch in seinem Arbeitsalltag Zeit findet. Dafür nutzt er verschiedene Methoden. Er liest gern Bücher in Brailleschrift, hört aber genau so gern Hörbücher, die es in Blindenbüchereien zum Ausleihen gibt. Da Bücher für Blinde oft teurer und größer sind als Standardausgaben, leiht er sich die meisten aus der Bücherei aus. Ein Beispiel: Die „Der Herr der Ringe“-Taschenbuch-Gesamtausgabe kostet als Buch mit Schrift etwa 40 Euro. Die Gesamtausgabe in Brailleschrift kostet etwa 100 Euro mehr. Kleine Texte oder Briefe scannt André mit einer Texterkennungssoftware, doch das ist mühsam und liefert nicht immer gute Ergebnisse.
Unabhängigkeit ist teuer
Durch seine eingeschränkte Mobilität hat André zusätzliche Kosten im Alltag: „Es fängt ja schon damit an, dass man manche Wege nicht unbedingt mit dem ÖPNV machen kann. Diese Wege fahre ich zum Beispiel mit dem Taxi.“ Auch beim Einkaufen muss er manchmal mehr bezahlen, da er auf Geschäfte angewiesen ist, die möglichst barrierefrei zu erreichen sind – selbst, wenn sie teurer sind als andere.
Regionale Unterschiede beim Blindengeld
Diese zusätzlich anfallenden Kosten kann André teilweise durch das Blindengeld decken, dessen Höhe vom Bundesland abhängt. Blinde, die in Hamburg wohnen, erhalten seit Juli letzten Jahres ein Blindengeld in Höhe von 670,43 Euro. Die Unterschiede zwischen den Ländern sind groß: Im benachbarten Schleswig-Holstein erhalten Blinde beispielsweise weniger als die Hälfte. Für André ein Faktor, den er bei einem Umzug berücksichtigen würde: „Ich würde mir schon zehn Mal überlegen, ob ich nach Pinneberg ziehe.“
In den meisten Bundesländern gibt es jedoch einen Unterschied zwischen Blindengeld für Erwachsene und für Jugendliche. Ausnahmen gelten in Bayern, Berlin, Hamburg, Niedersachsen und Thüringen – hier erhalten Blinde unabhängig vom Alter denselben Betrag. Eine weitere Unterteilung, die je nach Bundesland variiert, erfolgt anhand des jeweiligen Pflegegrads der betroffenen Person. Hier gibt es die Stufen Pflegegrad 2, Pflegegrad 3-5 und Bewohner*inen eines Pflegeheims oder Ähnlichem.
Pflegeleistungen, die Blinde ab Pflegegrad 2 beanspruchen, werden teilweise auf das Blindengeld angerechnet. Sie erhalten die erforderlichen Leistungen aus der Pflegeversicherung sowie ein reduziertes Blindengeld. Bewohner*innen von Einrichtungen wie Pflegeheimen erhalten ein gekürztes Blindengeld, wenn öffentlich-rechtliche Leistungsträger die Kosten ihres Aufenthalts ganz oder teilweise übernehmen. Das Blindengeld beträgt dabei jedoch immer mindestens 335,22 Euro monatlich.
Pflegegerade zeigen an, wie selbstständig eine Person ist. Pflegebedürftige mit Pflegegrad fünf sind am stärksten auf Hilfe angewiesen. Die zu bewertenden Module unterteilen sich dabei in Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakt. Ein Pflegegrad wird durch einen Antrag bei der Pflegekasse beantragt. Dafür muss ein Gutachten vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung erfolgen, der den entsprechenden Pflegebedarf bewertet.
Die Stadt Hamburg hatte im Jahr 2004 im Verhältnis höhere Ausgaben als Steuereinnahmen. Trotz Fortschritten bei der Haushaltsplanung in den vorherigen vier Jahren war die Haushaltslage der Stadt angespannt. Folglich nahm die Stadt Hamburg 2005 Kürzungen vor – unter anderem beim Blindengeld.
„Ansonsten sind wir immer noch Menschen“
Barrierefreiheit ist in Deutschland mittlerweile ein großes Thema, aber wenig mit Blick auf blinde und sehbehinderte Menschen. Fehlende Orientierung im ÖPNV, den Weg versperrende E-Roller, finanzieller Mehraufwand. Probleme, die teilweise seit Jahrzehnten existieren, aber nicht vollständig beseitigt werden.
Am Ende unseres Gesprächs mit André fragen wir, ob die Gesellschaft blinde und sehbehinderte Personen genug mitdenkt. Die Frage können wir kaum zu Ende aussprechen, schon unterbricht uns André mit einem klaren „Nein.“ Noch immer würden behinderte Menschen zu stark ausgeschlossen. Als Beispiel nennt André Förderschulen – auch er war seine gesamte Schulzeit auf speziellen Schulen für blinde Kinder und Jugendliche. Die fehlende Inklusion im Kindesalter lege schon den Weg für das restliche Leben fest.
Was er sich von der Gesellschaft wünscht? Einfach ganz normal mit Blinden umgehen. „Wir kriegen auch keine Ausbildung, wie wir damit klarkommen. Die Behinderung ist ein deutliches Merkmal, aber doch nicht das einzige, was uns ausmacht. Ansonsten sind wir immer noch Menschen.“