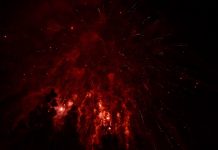Im Oktober 2025 übten Einsatzkräfte am Campus der HAW Hamburg in Bergedorf einen Massenanfall von Verletzten. Die Situationen waren simuliert, die Erkenntnisse für einen Ernstfall echt – und potenziell lebensrettend.
Disclaimer: Im Folgenden werden simulierte, aber schwere Verletzungen erwähnt. Auf manchen Bildern sind mit Kunstblut und Wachs geschminkte Verletzungen zu sehen. Die Patient*innen wurden von Darsteller*innen gespielt.
„Polizei!”, schallt es am 11. Oktober 2025 über den Campus Bergedorf der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW). Eine Gruppe aus etwa zwei Dutzend vermummten Beamt*innen vom Spezialeinsatzkommando (SEK) läuft kurz darauf in dichter Formation um die mit Hecken begrünte Einfahrt zum Parkplatz. Sie tragen volle Uniformen in Tarnfarben, Helme, Schusswesten und Übungswaffen. Sie folgen einer jungen Frau, die aufgelöst schreit und mit dem Finger in Richtung des Eingangs der Fakultät Life Sciences zeigt. Es ist genau 10:10 Uhr. Wenige Momente später stürmt das SEK das Gebäude. „Polizei!”, identifizieren sich die Beamt*innen dabei erneut laut.

„Jetzt ist es entspannt”, sagt Jule Hielscher, die dem Geschehen vom Parkplatz aus zusieht. „Wir können nichts mehr machen, nur noch beobachten und warten.”
Hielscher ist Bachelorstudentin im Studiengang Rettungsingenieurwesen an der HAW. Gemeinsam mit Prof. Dr. Boris Tolg und sechs anderen Student*innen hat sie den heutigen Tag als Studienprojekt zehn Monate lang vorbereitet. Was aussieht wie ein großangelegter Notfalleinsatz, ist eine gründlich geplante Übung – eine realitätsnahe Simulation eines Massenanfalls von Verletzten (MANV).
Bei einem Massenanfall von Verletzten muss eine größere Anzahl von Betroffenen und Verletzten versorgt werden. Dazu zählen Einsätze, die aufgrund ihres Ausmaßes besondere organisatorische Maßnahmen erfordern, zum Beispiel Naturkatastrophen oder Großunfälle wie Zugentgleisungen.
Die Akteur*innen: Darstellende, Einsatzkräfte und Studierende
Die von den Student*innen der HAW Hamburg organisierte MANV-Übung findet alle zwei Jahre statt, erklärt Hielscher. Die Szenarien wechseln sich ab, heute werde eine sogenannte Sicherheitsstörung in einem größeren Gebäude simuliert. Die Einsatzkräfte üben, drei bewaffnete Personen zu überwältigen und die von ihnen verletzten Patient*innen möglichst schnell in Sicherheit zu bringen.
Neben dem SEK der Polizei sind Einheiten der Hamburger Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Für sie alle geht es darum, das Szenario gemeinsam zu lösen, Fehler und Verzögerungen in Abläufen zu identifizieren und daraus möglicherweise lebensrettende Erkenntnisse für den Ernstfall zu ziehen.
„Wollt ihr mitkommen? Wir bauen jetzt Molotovs.” – Jule Hielscher
Einige Stunden vorher, kurz vor sieben Uhr morgens. Das Studierenden-Team – zusammengesetzt aus den Bachelor-Studiengängen Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr sowie dem Master-Studiengang Biomedical Engineering – ist seit fast einer Stunde vor Ort. Mit rot-weiß-gestreiftem Flatterband und Schildern haben sie einen Teil des denkmalgeschützten, brutalistischen Campus-Gebäudes für die Übung abgesperrt.

Jule Hielscher und vier der anderen Studierenden machen sich mit zwei Glasflaschen ausgestattet auf den Weg durchs Gebäude. „Wollt ihr mitkommen? Wir bauen jetzt Molotovs”, sagt Hielscher. Wenige Minuten später ist im Erdgeschoss ein lautes Klirren zu hören. Es riecht nach Rauch. Für eine realistische Darstellung haben die Student*innen zwei Molotov-Attrappen aus Filmglas auf den Boden geworfen und Brandgeruch-Spray versprüht.
Die Einsatzkräfte müssen für die heutige Übung vier Situationen in den Griff bekommen, erklärt Hielscher. Die zwei Molotov-Attrappen im Foyer des Campus stellen jeweils ein Brandszenario dar. Im zweiten Stock werde einer der Unterrichtsräume zum Tatort: Hier simuliere eine lebensgroße Puppe später einen Toten, meint die Studentin. Drei Stockwerke tiefer, im Keller, halten sich während der Übung unverletzte Betroffene auf. Diese haben sich im verwinkelten System aus Gängen versteckt. Die Einsatzkräfte müssen sie finden und sicher nach draußen bringen.
Kunstblut und Dermawachs simulieren den Ernstfall
Um 7:30 Uhr ist es im Erdgeschoss ruhig. Draußen ist es noch dunkel, im Foyer ist niemand zu sehen. Auf der Treppe in den ersten Stock wird es allmählich lauter – dort haben sich die bereits anwesenden Übungsteilnehmenden versammelt. Es gibt belegte Brötchen und Kaffee.
Einer der Unterrichtsräume ist besonders gut besucht. Die Tische sind mit dunkelblauen Vliestüchern abgedeckt. Darauf stehen kleine Tiegel gefüllt mit Farbpasten, Fläschchen mit Aufschriften wie „kalter Schweiß” und Setzkästen, die Schwämme, Pinsel und allerlei andere Schminkutensilien beinhalten.
Mitglieder des Roten Kreuzes sorgen hier für den nötigen Realismus – sie schminken den Darstellenden täuschend echt wirkende Wunden auf die Haut. Durch Kunstblut und auf der Haut klebendem Dermawachs entstehen dreidimensionale Brandverletzungen und Schusswunden. Ein Darsteller scheint am Ende gar eine Glasscheibe im Kopf stecken zu haben.




„Wir schreien und nerven rum, um die Einsatzkräfte auf die Belastungen im Einsatzfall vorzubereiten.” – Dennis Andrzejewski

Dennis Andrzejewski spielt heute einen sogenannten roten Patienten, also einen Schwerverletzten. „Ich wurde durch den linken Lungenflügel angeschossen”, erklärt er während er durch ein Loch in seinem T-Shirt die geschminkte Eintrittswunde zeigt. „Ich kriege sehr schlecht Luft. Dadurch habe ich einen schlechten Kreislauf und kann mich nicht richtig unterhalten.”
Die Darstellenden sowie die Betreuer*innen, die ihnen während der Übung zur Seite stehen, haben selbst Erfahrung im Rettungsdienst oder der Feuerwehr. Sie wissen, was zu realen Einsätzen dazugehört. „Wir schreien und nerven rum, um die Einsatzkräfte auf die Belastungen im Einsatzfall vorzubereiten”, sagt Andrzejewski.
Wollt ihr herausfinden, wie die Übung gelaufen ist und welche Details sie besonders authentisch gemacht haben? Im Behind-the-Scenes-Beitrag von FINK.HAMBURG könnt ihr hinter die Kulissen der Simulation blicken.
Koordiniertes Chaos
10:11 Uhr: Die SEK-Beamt*innen betreten das Gebäude. Auf dem Parkplatz kehrt fürs Erste wieder gespannte Ruhe ein. Zehn Minuten später, um 10:21 Uhr treffen die ersten Wagen der Rettungskräfte und Feuerwehr mit Blaulicht ein. Der leitende Notarzt und der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes laufen gemeinsam über den Platz. Sie ordnen den Raum und besprechen, wo die SEK-Beamt*innen am besten Patient*innen an die Rettungskräfte übergeben können.
Um 10:44 Uhr wimmelt es am Parkplatz nur so vor Einsatzkräften, die Rettungstücher vorbereiten und auf die ersten Patient*innen warten. Diese kommen fünf Minuten später aus dem Gebäude. Je nach Grad ihrer simulierten Verletzungen können manche noch laufen, andere werden von den SEK-Beamt*innen unterstützt und dem Rettungsdienst übergeben.




Jeder Schritt wird für den Ernstfall analysiert
Zwischen den Rettungswägen, Einsatzkräften und SEK-Beamt*innen stehen gruppenweise junge Menschen mit schwarzen Westen. Die neon-gelben Buchstaben auf ihren Rücken weisen sie als Beobachter*innen aus. Verteilt auf dem Parkplatz, dokumentieren sie auf Klemmbrettern zum Beispiel zeitliche Abläufe und die Klarheit der Rollenverteilung. Zudem beobachten sie, wie die Einsatzkräfte miteinander agieren und kommunizieren.

Die Darstellenden und die Einsatzkräfte tragen außerdem sogenannte Geo-Logger mit sich. Diese sehen aus wie kleine USB-Sticks und zeichnen außerhalb des Gebäudes den Standort in Echtzeit auf. Daraus lässt sich später ableiten, wie schnell die Patient*innen versorgt wurden und das Gelände verlassen haben. Zudem geben sie nach der Übung Auskunft darüber, wie sich Rettungskräfte am Einsatzort bewegt haben und inwieweit der vorhandene Raum effizient eingeteilt worden ist.
Dr. Boris Tolg ist Professor für Informatik und Mathematik an der Fakultät Life Sciences der HAW Hamburg. Er leitet seit zehn Jahren das Simulationslabor der Hochschule, das im MANV-Analyse-Projekt der Student*innen eine zentrale Rolle einnimmt. Tolg hat eine Software geschrieben, die die Daten aller Geo-Logger zusammenfügt und mit ihnen ein zusammenhängendes Abbild der Übung skizziert.
Die Daten würden wissenschaftlich genutzt, kämen aber auch den anwesenden Organisationen zugute. „Wenn wir mit der gleichen Organisation mehrfach zusammenarbeiten, können wir über die verschiedenen Übungen hinweg sehen, ob sich Abläufe verbessert haben”, sagt Tolg.
Die Action ist vorbei, die Resultate warten
Die Rettungskräfte tragen Dennis Andrzejewski, den „Patienten” aus dem Schminkraum, um 10:53 Uhr aus dem Gebäude. Er liegt auf einer Trage, ist mit einer goldenen Rettungsdecke zugedeckt und mit Gurten festgezurrt. Zwei Rettungskräfte rollen ihn zu einem der Rettungswagen, sein Betreuer läuft hinterher.

Um 11:26 Uhr führen drei Feuerwehrleute eine Reihe von 28 Darstellenden vom Gebäude weg. Sie sind unverletzt und können selbst laufen, halten sich an den Schultern der Person vor ihnen fest. Neun Minuten später ruft der organisatorische Leiter der Übung aus, dass alle Simulationspatient*innen aus dem Gebäude gebracht und an Rettungskräfte übergeben wurden.
Um 11:36 Uhr kommen 13 der SEK-Beamt*innen aus dem Gebäude, 13 weitere rücken acht Minuten später ab. So schnell wie die Übung eineinhalb Stunden zuvor Fahrt aufnahm, ist sie wieder vorbei, zumindest der aktive Teil.
Direkt nach der Übung findet eine erste Nachbesprechung mit den Organisationen statt, in der herausstechende Momente diskutiert und ein erstes Fazit gezogen wird. Eine zweite Nachbesprechung folge, sobald die Daten ausgewertet wurden. Das könne ein paar Monate dauern, meint Boris Tolg.
Vorerst hat Jule Hielscher ein organisatorisches Fazit: „Wir sind ein bisschen früher fertig als geplant. Alles andere wird sich jetzt ergeben in der Auswertung.” Erstmal, sagt sie und lacht, habe sie jetzt Hunger auf das geplante Mittagessen.