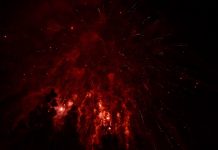Seit Jahren gab es nicht mehr so viele Kriege und bewaffnete Konflikte wie heute. FINK.HAMBURG-Redakteurin Kristin Müller findet, dass es gerade deswegen wichtig ist, eine Balance zwischen Informiertheit und mentaler Gesundheit zu finden – und Hoffnung zu bewahren.
Titelbild: Illustration von Maria Hüttl, Icon: Illustration von Elizaveta Schefler
Erneut russische Luftangriffe auf Kiew; Libanon meldet Angriffe auf den Süden Beiruts; Mindestens 20 Tote bei israelischen Angriffen in Gaza – fast jeden Tag hinterlässt die Tagesschau mir Push-Benachrichtigungen wie diese auf meinem Sperrbildschirm. Als wären eine Klimakrise und weltweite Pandemie noch nicht genug, nimmt die Zahl der Kriege und Konflikte immer weiter zu. Ich will informiert sein über das, was passiert, aber je mehr Nachrichten ich lese, desto frustrierter werde ich.
Wo soll das hinführen? Wie viele Menschen müssen noch sterben? Wie sieht die Welt in ein paar Jahren überhaupt aus?
Serie “Aus den 20ern”
FINK.HAMBURG hat Personen unter dreißig befragt, welche Themen sie gerade beschäftigen. Diesen Themen wurde jeweils eine Folge der Serie gewidmet – um sie zu diskutieren, Lösungsansätze zu bieten und einen Raum zu kreieren. Barbara, 22 hat gesagt: “ Thinking about the world, makes me nervous, the conflicts that are going on. Especially in Gaza and Ukraine.”Die Serie erscheint jeden Donnerstag hier auf FINK.HAMBURG.
Mit solchen Gedanken bin ich nicht alleine. Fast 40 Prozent der europäischen 16- bis 26-Jährigen blicken laut der Jugendstudie der TUI-Stiftung pessimistisch in die Zukunft. Die Trendstudie “Jugend in Deutschland” verdeutlicht, wie viele von uns sich gestresst und hilflos fühlen. Die Kriege in der Ukraine und Nahost stehen ganz weit oben auf der Sorgenliste.
Nachrichtenvermeidung vs. Doomscrolling?

Immer mehr junge Menschen meiden laut dem Digital News Report 2024 aktiv Nachrichten, weil sie von der Menge erschöpft sind und negative Auswirkungen auf ihre Stimmung vermeiden wollen. Fast 70 Prozent der 18- bis 24-Jährigen tun es mindestens gelegentlich. Und ich verstehe sie gut. Besonders, wenn abends in meinem Instagram-Feed zwischen Rezepten und Urlaubsbildern plötzlich Reels von zusammenfallenden Häusern auftauchen. Dann von trauernden Angehörigen und hungernden, schwerverletzten Kindern und es dann gar nicht mehr aufhört. Dann ist mir zum Heulen zu Mute.
Mit jeder neuen schlechten Nachricht passiert bei mir aber noch etwas anderes – ganz langsam und unterbewusst, stumpfe ich emotional ab. Im Gespräch mit Freund*innen merke ich, dass ich damit nicht alleine bin. „Es passiert so viel Schlimmes, dass ich gar nicht mehr richtig davon geschockt bin,” hat mir eine Freundin verraten. Bleibt uns also nur die Wahl zwischen Pessimismus und Empathielosigkeit?
Zwischen Informiertheit, mentaler Gesundheit und Empathie
Dr. Sascha Hölig und Julia Behre vom Leibniz-Institut für Medienforschung empfehlen zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die eigene mentale Gesundheit einen „achtsamen Umgang mit der eigenen Nachrichtennutzung”. Das kann heißen, sich bewusster mit Inhalten auseinanderzusetzen oder gezielt nach konstruktiver Berichterstattung zu suchen, in der es um Lösungsansätze oder Fortschritte geht. Und ja: Manchmal hilft auch eine Pause. Hin und wieder verbiete ich der Tagesschau-App deshalb, mir Push-Benachrichtigungen zu schicken.
wer Nachrichten auf Dauer meidet,
wird irgendwann ignorant. Ignorant gegenüber dem Leid der Menschen, die die Konflikte erleben, die wir auf unseren Bildschirmen verfolgen.
Aber wer Nachrichten auf Dauer meidet, wird irgendwann ignorant. Ignorant gegenüber dem Leid der Menschen, die die Konflikte erleben, die wir auf unseren Bildschirmen verfolgen. Wir müssen eine Balance finden zwischen Informiertheit und mentaler Gesundheit und dürfen dabei unsere Empathie nicht verlieren.
Ein Perspektivwechsel kann helfen
Einer meiner Freunde gehört nicht zu den Pessimist*innen unserer Generation. „Es läuft zwar gerade nicht so gut, aber viele Dinge haben sich in den letzten Jahren positiv entwickelt“, sagt er und verweist beispielsweise darauf, dass Hunger und Armut weltweit stark gesunken sind. Und er hat recht. Wusstet ihr zum Beispiel, dass nur noch neun Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut leben? Immer noch zu viele, aber im Jahr 2000 waren es noch 30 Prozent.
Ich will mir erlauben, auch solche positiven Entwicklungen zu sehen und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Das bedeutet nicht, dass ich mich mit dem aktuellen Zustand zufriedengebe.
Ich bin zu recht frustriert. Aber ich will mich nicht dem Ohnmachtsgefühl ergeben, sondern Hoffnung haben. Unsere Unzufriedenheit, der Weltschmerz und Pessimismus sollten stattdessen unser Motor sein. Sie sollten uns antreiben, nach Wegen zu suchen, Dinge zum Besseren zu wenden und aktiv zu werden – egal in welchem Rahmen.
Mehr Texte "Aus den 20ern":
Gegensätze ziehen Kristin Müller, geboren 2001 in Ulm, regelrecht an. Sie wuchs in Baden-Württemberg auf, spricht allerdings kein Schwäbisch, trinkt gerne Guinness, mag aber eigentlich kein Bier und hat sich tierisch über den Cliffhanger aus Crescent City aufgeregt – nur um den nächsten Band nicht zu lesen. Nach ihren journalistischen Anfängen bei der Walsroder Zeitung landete sie während des Studiums im Community Management des Stadtportals “bremen.de” und bei der Social Media Agentur Himmelrenner. Für den Master wurde die selbsterklärte Bremen-Liebhaberin schließlich zur Wahl-Hamburgerin. Kein Gegensatz, wie Kristin findet.
Kürzel: mü