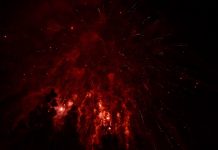Das Streben nach Kompetenz gilt als menschliches Grundbedürfnis. Doch was ist, wenn man sich so gar nicht kompetent und fähig, sondern unsicher und fehl am Platz fühlt? Unser Autor Simon Laumayer geht der Frage nach, wie man mit dem Impostor-Syndrom im Berufseinstieg umgeht.
Titelbild: Illustration von Alex Eigner, Icon: Illustration von Elizaveta Schefler
Spätestens mit 30 sollte man wissen, wo man beruflich steht. Dieses Credo wurde mir als Kind so tief eingeprägt, dass der 30. Geburtstag mir noch jahrelang wie eine unsichtbare Grenze vorkam, mit deren Überschreiten man sich in einen reifen Erwachsenen verwandelt, der mit professioneller Souveränität und adretter Aktentasche täglich von 9 bis 17 Uhr die Karriereleiter erklimmt.
Passend dazu kamen mir Menschen über 30 immer vor, als hätten sie ihr Leben im Griff und wüssten genau, was sie tun – vor allem beruflich. Doch was ist, wenn man selbst diese Grenze überschreitet und auf einmal merkt, dass man immer noch nicht das Gefühl hat, wirklich zu wissen, was man tut? Was, wenn sich statt Professionalität vor allem eins einstellt: das Gefühl, nicht so gut zu sein wie alle anderen?
Aus dem Hörsaal ins Berufsleben
Bereits in der Uni gab es Momente, in denen mir langsam klar wurde: Irgendetwas verändert sich hier gerade. Gingen Gespräche in der Schule oder den frühen Uni-Semestern noch darum, wie es mit dem Hobby läuft oder was man in den Ferien plant, drehte es sich spätestens zum Ende des Bachelors zunehmend um ein Hauptthema: den Berufseinstieg.
Während ich selbst verzweifelt versuchte, Alltagsorganisation, Hobbys, soziale Beziehungen und universitäre Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen, feilten andere schon an ihrem beruflichen Profil und erzählten auf Hauspartys von Forschungsprojekten, Publikationen oder der anspruchsvollen Werksstudierendenstelle mit guten Aussichten auf spätere Übernahme.

Hörte man diesen Menschen zu, fragte man sich vor allem eins: Was mache ich hier eigentlich? Bin ich hier komplett fehl am Platz? Dass man es selbst auch durch die Aufnahmeprüfung für den Studiengang geschafft hat, die letzten Klausuren mit überdurchschnittlichen Noten bestanden und für seine letzte Hausarbeit überschwänglich vom Dozenten gelobt wurde, spielt auf einmal keine Rolle mehr.
Gleiches gilt für die ersten Jobs und Praktika. Egal ob man das erste Mal in einer richtigen Redaktion sitzt, oder anfängt, erste Unterrichtseinheiten für Grundschüler*innen zu konzipieren – ständig beschleicht einen das Gefühl, alle wüssten genau, was sie tun – außer man selbst.
Alles nur ein Schwindel?
Studien zeigen, dass etwa 70 Prozent aller Menschen schon einmal das Gefühl hatten, nicht gut genug in dem zu sein, was sie tun – und das teilweise trotz offensichtlicher Qualifikationen. Dieses Phänomen hat auch einen Namen: das „Hochstapler-“ oder „Impostor-Syndrom“. Dahinter steht das Gefühl, seinem Umfeld nur vorzugaukeln, man wäre qualifiziert. Oft verbunden mit der Angst, man könne jederzeit enttarnt werden. Betroffene haben oft Probleme, ihre eigenen Leistungen anzuerkennen und fühlen sich in ihren Positionen unsicher. Das kann auf lange Sicht zu einer Vielzahl psychologischer Krankheiten wie Burn-out oder Depressionen führen.
Serie „Aus den 20ern“
Berufseinstieg, Freundschaft, Heirat: FINK.HAMBURG hat Personen unter dreißig befragt, welche Themen sie gerade beschäftigen. Jedem Thema ist ein Teil der Serie gewidmet – um darüber zu diskutieren, eigene Erfahrungen zu teilen und Lösungen zu finden. Oliver (27) auf die Frage, was ihn beschäftigt: „Alle auf Arbeit tun so, als hätten sie einen Plan, aber eigentlich haben sie auch keinen Plan. Aber auch bei mir kickt das Impostor-Syndrom ganz stark.” Die Serie erscheint jeden Donnerstag hier auf FINK.HAMBURG.
Gründe für das Impostor-Syndrom gibt es viele. Oft spielen hohe Erwartungen der Eltern in der Kindheit eine Rolle. Das gilt auch für positive Rollenzuschreibungen. Betiteln Eltern ihre Kinder oft als besonders „intelligent“ oder „talentiert“, können diese unter ständigem Stress stehen, diesen Labels gerecht zu werden. Auch Kategorien wie die soziale Zugehörigkeit und Geschlecht sind relevant. So sind laut einer Metaanalyse aus 2024 Frauen häufiger betroffen als Männer. Auch Personen, die ethnischen Minderheiten angehören, berichten häufiger von Hochstapler-Gefühlen.
Der soziale Vergleich spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Denn wer ständig die eigenen Erfolge mit denen anderer misst, fühlt sich schnell klein. Die sozialen Medien verstärken diesen Effekt. Frei nach dem Sprichwort: Des Glückes Tod ist der Vergleich.
Kompetenz als zentrales Bedürfnis
Kompetent zu sein und auch so wahrgenommen zu werden, ist ein zentrales menschliches Bedürfnis. Studien zeigen, dass bei etwa 60 Prozent aller Befragten ein erfülltes Kompetenzbedürfnis mit gesteigerter Arbeitszufriedenheit und einem verbesserten allgemeinen Wohlbefinden einhergeht. Die „Selbstbestimmungstheorie“ der Psychologen Edward Deci und Richard Ryan versteht „Mastery“, also das Streben nach Können und Kompetenz, sogar als eine von drei zentralen Säulen für menschliche Motivation und Zufriedenheit.
Und wann soll man den Grundstein für diese Kompetenzen legen, wenn nicht in seinen Zwanzigern? Der Zeit zwischen Schullaufbahn und Arbeitswelt? Manchmal habe ich das Gefühl, die Hauptaufgabe in dieser Lebensphase ist genau die: In irgendetwas so gut zu werden, dass die Köpfe anerkennend nicken, wenn man davon erzählt. Was soll man auch sonst denken, wenn die erste Frage eines jeden Small Talks fast immer die Frage nach dem Beruf ist? Wenn man das Leuchten in den Augen der Zuhörenden sieht, wenn der beste Freund von seiner Promotion oder die Cousine von ihrer Unternehmensgründung erzählt?
„Zweifel können einen motivieren, sich zu verbessern oder einem den Mut geben, in ein passenderes Berufsfeld zu wechseln.“
Zweifel an den eigenen Kompetenzen sind normal – gerade in der beruflichen Findungsphase. Und an sich und seinen Fähigkeiten zu zweifeln, muss nicht immer schlecht sein. Zweifel können einen motivieren, sich zu verbessern oder einem den Mut geben, in ein passenderes Berufsfeld zu wechseln. Wichtig ist nur, dass man trotz aller Zweifel und Unsicherheiten nie seine Kompetenzen und Erfolge vergisst.
Denn vielleicht ist gerade das am Ende die Kunst: Der Cousine zuzuhören, anerkennend zu nicken, das Ganze aber nicht auf sich zu beziehen. Sich zu freuen, dass Freund*innen und Bekannte Erfolg haben und in dem aufgehen, was sie tun, ohne sich selbst abzuwerten.
Simon Laumayer, Jahrgang 1992, ist mit 16 Jahren schon Schulmeister im Bouldern geworden. Seit seinem Bachelorstudium Kulturwissenschaften in Lüneburg verdient er sogar Geld damit - als Routenbauer in der Boulderhalle. Auch im Urlaub klettert der gebürtige Hamburger. In einem selbst ausgebauten Van, einem Gärtnermobil, geht es zu Felsformationen, am liebsten in die Schweiz. Als Pressesprecher hat Simon mehrere Jahre fürs Lüneburger Musik- und Kulturfestival “Lunatic” gearbeitet und für den “Rolling Stone” schon den Indie-Künstler Sam Fender interviewt. Privat dröhnt allerdings Hiphop aus den Boxen seines Vans.
Kürzel: sil