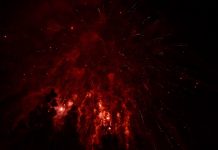In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 fegt der Orkan “Vincinette” über Norddeutschland hinweg. Besonders in Hamburg sind die Schäden verheerend. Die große Sturmflut hat die Stadt für immer veränderte.
Ein Beitrag von Ole-Jonathan Gömmel und Jan-Eric Kroeger.
Als sich Gernot Mader am Morgen des 17. Februar 1962 von seiner Stube auf den Weg zum Kasernentor der Plöner Fünf-Seen-Kaserne macht, glaubt er noch, am Mittag an einem Leichtathletik-Hallensportfest teilzunehmen. Der 21-jährige Offiziersanwärter der 4. Kompanie des Pionier-Bataillons 6 ist begeisterter Sportler und möchte seinen selbst entworfenen Hochsprungschuh ausprobieren. Der Wettkampf, den Mader an diesem Tag bestreiten wird, ist jedoch keiner um Bestzeiten und Höchstweiten – sondern um Leben und Tod.

„Als ich am Kasernentor ankam, durfte ich das Gelände nicht mehr verlassen“, erinnert sich der heute 81-Jährige zurück. Warum, ist ihm zu dem Zeitpunkt nicht klar. Dass es im Westen Schleswig-Holsteins ein gewaltiges Unwetter geben sollte, hat er in den Tagen zuvor zwar mitbekommen – welche Auswirkungen der Orkan “Vincinette” tatsächlich hat, wird ihm jedoch erst bewusst, als er ein paar Stunden später in Hamburg aus dem Truppentransportfahrzeug tritt.
„Nachdem ich am Kasernentor aufgehalten wurde, ging alles ganz schnell: Meine Kameraden und ich wurden auf Fahrzeuge verteilt und dann fuhren wir mit ordentlich Tempo Richtung Süden“, erzählt Mader. Wo genau er am Mittag des 17. Februar in Hamburg ankommt, weiß er nicht mehr. Vielleicht in Wilhelmsburg, vielleicht in Waltershof. Was sich jedoch in seinem Kopf festsetzt, sind Bilder – Bilder einer Katastrophe.
An 60 Stellen brechen in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar die Hamburger Deiche. Der Morgen danach enthüllt eine Stadt, die zu einem Sechstel unter Wasser steht. Innensenator Helmut Schmidt geht am Tag nach der Flut von circa 10.000 Menschen in Lebensgefahr aus. Da die Krisenkommunikation zwischen Polizei, Feuerwehr und Senatskanzlei sehr unkoordiniert abläuft, beschließt er kurzerhand, bei Nato und Bundeswehr um Katastrophenhilfe zu bitten. Er verstößt damit zwar gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik, rettet durch die unbürokratische Handlungsweise aber wohl etlichen Menschen das Leben.
Rettung im Chaos
Gemeinsam mit einem Obergefreiten besteigt Mader nach seiner Ankunft ein Motorboot. Konkrete Befehle von Vorgesetzten gibt es keine. Klar ist nur: Menschen, die vom Wasser eingeschlossen sind, sollen gerettet werden – wie genau, wird den jungen Pionieren allerdings selbst überlassen. Als der 21-Jährige mit seinem Kameraden das erste Mal ausrückt, hat er das Kommando im Boot. „Um uns herum ergoss sich ein Meer aus Dächern und Straßenschildern, die grade so über die Wasseroberfläche ragten“, schildert Mader die Situation. „Manchmal leuchtete es aus der Tiefe der Flut rötlich auf – das waren die Lichter abgesoffener Pkw.“ In diesem Moment weiß er, dass sich unter seinem Boot eine Welt befindet, die verloren ist – ihre Bewohner sind es jedoch noch nicht.

Im Akkord retten Mader und sein Kamerad anschließend Menschen von Dächern, Bäumen oder aus höheren Etagen überfluteter Häuser. Die häufig unterkühlten und unter Schock stehenden Hamburger:innen werden mit dem Boot in das Basislager der Pioniere gebracht – eine Kirche auf einer Anhöhe, die wie eine sichere Insel aus den Fluten herausragt. Zeit für Pausen gibt es zwischen den Einsätzen keine. „Wir saßen im Kirchenvorraum und sind vor Erschöpfung weggenickt. Bevor man richtig einschlief, ging es dann aber wieder los zur nächsten Einsatzfahrt.“
Die Stadtteile Wilhelmsburg und Waltershof sind besonders von der Sturmflut betroffen. Viele Menschen wohnen dort in Lauben, die nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurden, um Ausgebombten oder Geflüchteten ein neues Zuhause zu bieten. Nach der Katastrophe wird Waltershof nicht mehr besiedelt. In ganz Hamburg verlieren 20.000 Menschen durch die Fluten ihr Zuhause.
“Opa muss auch noch mit!”
An eine der Fahrten erinnert sich Mader besonders gut: Nachdem sein Motorboot diverse schwimmende Tierkadaver passiert, erreicht er ein Haus, bei dem das Wasser bis zur ersten Etage steht. Aus dem dortigen Fenster ruft eine Familie verzweifelt um Hilfe. Schnell werden Frauen und Kinder an Bord des wackeligen Untersatzes gebracht, dann folgen die Männer. Als das Boot die vorgeschriebene Höchstzahl an Passagieren erreicht, will Mader ablegen. Eine Frau hindert ihn jedoch daran.
„Sie flehte mich an und sagte ‚Opa muss auch noch mit‘, erzählt Mader. Er bemerkt den alten Mann, der eigentlich nicht mehr aufs Boot passt, und beginnt zu grübeln. Die Gefahr, bei einer Überfüllung zu kentern, ist bei den Wellen, die durch andere Boote erzeugt werden, hoch. Andererseits möchte er den Senioren nicht in der Katastrophe zurücklassen. Mader blickt auf den Wasserstand außerhalb des Bootes und entscheidet, den älteren Herren mitzunehmen. Der Mut wird belohnt – alle Insassen kommen sicher an der Kirche an.
Neben etlichen Booten sind bei den Rettungsaktionen auch 150 Hubschrauber der Bundeswehr und 40 der US-Airforce im Katastrophengebiet im Einsatz. Unterstützt werden die staatlichen Helfer:innen durch die solidarische Bevölkerung. Diese lässt Flut-Opfer bei sich wohnen oder versorgt sie mit Essen. Innerhalb der ersten vier Tage wird Betroffenen so 10.000 Liter Milch, 1600 Kilogramm Butter und 1000 Kilogramm Brot zur Verfügung gestellt. Insgesamt sind 25.000 Helfer:innen im Einsatz.
Korn statt Wasser
„Vorkommen, die mich berührt haben, sitzen auch heute noch tief in meiner Erinnerung“, sagt Mader, wenn er an die Situation zurückdenkt. Dass seine Entscheidung in diesem Fall wohl eine über Leben und Tod war, habe er erst später realisiert. „In dem Moment funktionierte ich einfach. Auch wenn um mich herum viel Leid und Elend zu sehen war, habe ich mich ohne Emotionalität auf meine Aufgabe fokussieren können.“
Dies sei zum einen der militärischen Ausbildung zuzurechnen, anderseits seiner persönlichen Geschichte. „Als Kind bin ich mit meinen Eltern nach Kriegsende aus Stralsund in den Westen geflohen. Dabei habe ich Dinge gesehen und erlebt, die mich für die Zukunft abgehärtet haben – deshalb konnten mich die Bilder der Flut vielleicht nicht mehr so schockieren“, sagt Mader.

Insgesamt drei Tage fährt der junge Soldat aus Schleswig-Holstein mit seinem Boot durch den Hamburger Süden. „Wenn ich daran zurückdenke, wundere ich mich schon, dass wir in dieser Zeit fast komplett ohne Schlaf und Nahrung ausgekommen sind.“ Nachdem sich das Wasser recht schnell aus der Hansestadt zurückzieht, wird Maders Kompanie zur Deichsicherung an der Nordseeküste eingesetzt. Um letzte Kräfte zu mobilisieren, versorgen verzweifelte, aber dankbare Bauern die überarbeiteten Soldaten mit Korn. Das bekommt nicht jedem. „Ich erinnere mich an einen Kameraden, der während des Marschierens einschlief. Wie in Trance ist er mit geschlossenen Augen weitergelaufen.“ Nach einigen weiteren Tagen endet der Fluteinsatz für Mader schließlich. Was bleibt, sind prägende Erfahrungen, die er nie mehr vergessen wird, und eine Dankmedaille der Stadt Hamburg.
Nach der Flut gibt die Stadt Hamburg die traurigen Nachwirkungen bekannt. Es starben insgesamt 315 Menschen, 259 davon in Wilhelmsburg und Waltershof. Dazu verendeten schätzunngsweise 25.000 Tiere.
Eine unbequeme Wahrheit

Als Lehrer für Geografie hat sich Mader auch nach 1962 immer wieder mit dem Phänomen Hochwasser beschäftigt. Es sorgt ihn, dass ähnliche Ereignisse in Zukunft rapide zunehmen werden. „Wenn man die klimatische Entwicklung der Erde betrachtet, kann man eigentlich nur noch heulen“, sagt er, fügt jedoch gleich hinzu, dass man mit dieser Denkweise jedoch auch nicht weiterkomme. Sein eigenes Haus schützt er mit einer Drainage vor eventuellen Fluten. „Die Probleme, durch die Hochwasser entsteht, ändert das aber natürlich auch nicht.“
Wie konnte es zur Katastrophe kommen?
Dass der Orkan „Vincinette“ in Hamburg zur Katastrophe führt, liegt an der schlechten Vorbereitung der Stadt auf die Gefahren der Nordsee, sagt Christoph Strupp. Der promovierte Historiker und Mitarbeiter der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg sieht dabei zwei Faktoren als ausschlaggebend: „Zuerst ist vielen Leuten damals nicht mehr bewusst gewesen, dass sie im Prinzip an der Nordsee wohnen. Auch, wenn Sie 100 Kilometer landeinwärts leben“, erklärt der Experte für hamburgische Geschichte. Zum damaligen Zeitpunkt liegt die letzte große Flut in der Hansestadt über hundert Jahre zurück. „Zum anderen herrschte eine gewisse Sicherheit, dass die moderne Welt technisch eigentlich so aufgestellt ist, dass einem nichts passieren kann.“

Noch immer war der Krieg zu spüren
Erschwerend hinzu kommt, dass sich Deutschland 1962 noch im Aufbau neuer gesellschaftlicher und politischer Strukturen nach dem Zweiten Weltkrieg befindet. „Nach 1945 haben Katastrophen- und Zivilschutzaktivitäten keinen guten Ruf, weil es Erinnerungen an die Kriegsvorbereitungen des Deutschen Reiches weckte“, ergänzt Strupp. Die Flutkatastrophe ergiebt sich also aus mangelnden Sicherheitsvorkehrungen, einem fehlenden Gefahrenbewusstsein und politischen Entscheidungen. „Im Narrativ der Stadt nach 1962 hat sich sehr die Idee durchgesetzt, dass eigentlich niemand Schuld hatte“, sagt Strupp rückblickend.
Die meisten Todesopfer sind die Bewohner:innen von provisorischen Hütten in Wilhelmsburg. Geflüchtete, für die es gut 17 Jahre nach Ende des Krieges keine festen Heime in der Elbmetropole gibt. Eine weitere Folge, die der überstandene Zweite Weltkrieg mit sich bringt.

Zuspruch für die Bundeswehr
Heute ist vor allem Helmut Schmidts Rolle bei der Bewältigung der Flutkatastrophe in den Köpfen vieler präsent. Der damalige Polizeisenator und spätere Bundeskanzler übernimmt am Morgen des 17. Februar die Koordination des Krisenmanagements, weil sich der Erste Bürgermeister Paul Nevermann im Urlaub befindet. Vom Polizeipräsidium am heutigen Johannes-Brahms-Platz lenkt er die Rettungsmaßnahmen und bleibt danach vielen Hamburger:innen als kühler Stratege und unerschrockener, pragmatischer Entscheider in Erinnerung. Doch ist diese Wahrnehmung aus heutiger Sicht gerechtfertigt?
„In der Nacht waren bereits rund 1.500 Helfer im Einsatz. Das war, bevor Schmidt im Polizeipräsidium ankam. Aber er war es, der die Maßnahmen systematischer gestaltete“, ordnet Historiker Strupp ein. Dabei helfen ihm seine Kontakte zur jungen Bundeswehr und zur Nato. „Das positive Bild Schmidts bei der Katastrophe ist nicht völlig unberechtigt, aber die Sicht, dass niemand irgendwas tat, bevor er im Polizeipräsidium ankam, stimmt nicht ganz“, ordnet Strupp ein. Aus Schmidts Zeit als Bundestagsabgeordneter in Bonn zwischen 1953 und Januar 1962 ist er bestens vernetzt. Er bittet NATO-Verbündete, die Bundeswehr und stationierte Truppen der ehemaligen alliierten Besatzer um Hilfe. Und das, obwohl es dazu keine rechtliche Grundlage gab.
Todesopfer bei den Helfern
Erst seit 1968 ist in den Notstandsgesetzen geregelt, dass die Bundeswehr im Katastrophenfall im Innern eingreifen darf. 1955 gegründet, ist die Armee des neuen deutschen Staates in der Bevölkerung unbeliebt. Zu präsent sind die Schrecken des Krieges, zu groß die Befürchtungen vor einem unkontrollierbaren Waffenapparat, von dem neuerliche Aggression ausgehen könnte. Unverhofft erhält die Armee der Bundesrepublik mit der Sturmflut ihre erste Bewährungschance. Und sie nutzt sie.
„Der Hilfseinsatz ist unter großem persönlichem Einsatz geschehen, es hat Todesopfer auch auf Seiten der Helfer gegeben. Das ist in der Bevölkerung positiv aufgenommen worden, die Presseberichterstattung hat diesen Effekt verstärkt und langfristig gefestigt“, erklärt Strupp. Hubschrauberpiloten der Bundeswehr setzen sich über ein geltendes Flugverbot wegen des Sturms hinweg. Sie riskieren ihr Leben bei der Bergung und Versorgung der eingeschlossenen Bewohner:innen. Insgesamt fünf Helfende sterben bei Rettungsversuchen.

Als die Flut vorüber ist, die Überlebenden versorgt und die Toten geborgen, sind zehntausende Hamburger:innen obdachlos und rund 6.000 Gebäude zerstört. Bis zu einem Fünftel der Hansestadt steht zeitweise unter Wasser. Viel schwerer als die materiellen Schäden, die innerhalb weniger Monate repariert werden können, wiegen die psychischen Folgen der Katastrophe. „Viele Flutopfer wurden aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen und später in Randbezirke einquartiert. Neben dem Verlust von Angehörigen war dies eine häufige Ursache für Traumata bei den Betroffenen“, schätzt Strupp.
Müssen wir uns auf neue Katastrophen einstellen?
Eine Flutkatastrophe wie 1962 soll sich nicht wiederholen, da sind sich Zeitzeug:innen, Historiker:innen und Politiker:innen einig. Um dies zu gewährleisten, investiert die Stadt nach Angaben der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft jährlich 20 bis 30 Millionen Euro. “Mit dem Geld werden Instandhaltungsarbeiten der Deiche, der Ausbau automatisierter Schleusen und eine Erhöhung der Deichlinie vorangetrieben”, erklärt Renate Pinzke, Pressesprecherin der Behörde, FINK.HAMBURG auf Nachfrage. Bis 2050 sieht der aktuelle Bauplan der Stadt eine Anpassung der Deiche an den erwarteten Anstieg des Meeresspiegels vor.
Heute liegen die Deiche nach Angaben der Behörde je nach Lage zwischen 7,5 und 9,25 Metern über dem Meeresspiegel und sind somit durschnittlich zweieinhalb Meter höher als 1962. Angesichts des Klimawandels ist die Gefahr von Hochwasser jedoch weiterhin real. Überflutungen des Stadtgebiets werden die Hamburger:innen daher auch zukünftig nicht restlos verhindern können – wohl aber eine Katastrophe mit Toten und tausenden Obdachlosen.
Eier mit Schale essen, um potenter zu werden? Klingt blödsinnig, ist es wohl auch. Ole-Jonathan Gömmel, Jahrgang 1995, probierte es in Spanien während eines Interviews mit einem Marathonläufer auf dessen Empfehlung trotzdem aus. Beim Wohnort ist Ole weniger experimentierfreudig: Aufgewachsen in Pinneberg, Journalistik-Bachelor in Hamburg. Neben dem Studium philosophiert er im eigenen Podcast „Irrenhaus Unterhaus“ über den Alltag in der zweiten und dritten Liga. Bisherige Stationen: „Bento“, „Spiegel“ und „FUMS“. Ole mogelte sich einst auf die Bühne zum Rapper Yung Hurn. So viel Mut hat man eben, wenn man Eier mit Schale – äh, isst. (Kürzel: ojo)