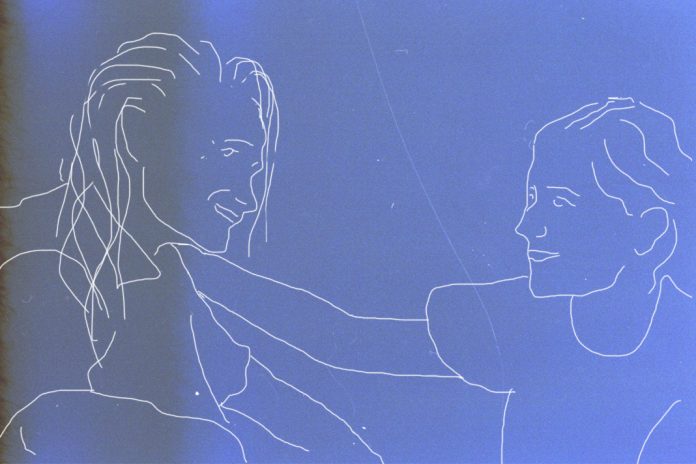Es ist ein Tabuthema unter Studierenden: Wer zu Hause seine Mutter oder seinen Vater pflegt, ist auf sich allein gestellt. Dabei brauchen die Betroffenen mehr Unterstützung und ein angepasstes Hochschulsystem.
Ich habe immer auf Besserung gehofft. Diese Hoffnung hat mich durch die Zeit getragen. Ich habe mir nie eingestanden, wie schlimm die Situation wirklich war.
Auch drei Jahre später fällt es Sophie* nicht leicht, über die bisher schwerste Zeit ihres Lebens zu sprechen. Zu tief sitzt der Schmerz, zu stark sind die Erinnerungen an die leidvolle Zeit. Die Eltern zu pflegen, ist gerade unter jungen Menschen ein sensibles Thema. Es offenbart intimste, familiäre Einblicke und berührt die Betroffenen noch viele Jahre später – auch wenn sich die Pflegesituation in der Zwischenzeit verbessert oder aufgelöst hat.
Sophie ist 24 Jahre alt, als ihre Mutter einen Schlaganfall erleidet. Sie studiert Modedesign an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg. Nach den Semesterferien im Sommer kommt sie in das fünfte Semester – die Zielgerade auf dem Weg zum Bachelor scheint erreicht. Doch um über Muster, Stoffe und Schnitte nachzudenken, bleibt für sie keine Zeit: Nach dem Schlaganfall sitzt ihre Mutter im Rollstuhl, kann ihren rechten Arm nicht bewegen und sich kaum verständigen. Sophie sagt: “In diesem Moment haben sich die Werte für mich total verschoben. Alles, was mir vorher wichtig erschien, rückte in den Hintergrund. Plötzlich ging es um ein existenzielles Problem – um Leben und Tod.”
Susann Aronsson vom Familienbüro der HAW kennt solche Fälle. Das Familienbüro berät pflegende Studierende, stellt Eltern eine Kindernotfallbetreuung zur Seite und kümmert sich um ausreichend Still- und Wickelräume an der Hochschule. Offizielle Zahlen, wie viele Studierende an der HAW Verwandte pflegen müssen, gibt es nicht. Doch allein zur vergangenen Fachgruppen-Tagung des Familienbüros haben sich 18 Studierende angemeldet. “Es ist ein Tabuthema unter Studierenden und auch Arbeitskollegen, obwohl es fast jeden betrifft. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich jeder jemanden kennt, der gepflegt wird oder sogar zu Hause selber pflegt”, sagt Aronsson.
Auf einmal ganz allein
Nach dem Schlaganfall ihrer Mutter legt Sophie ein Urlaubssemester ein. Sie muss sich um eine behindertengerechte Wohnung kümmern und entschließt sich zusammen mit ihrem Freund und ihrer Mutter in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. So kann sie nah bei ihr sein und sich um sie kümmern. Für das Waschen, Duschen, Baden und den Toilettengang ist ein Pflegedienst zuständig, den Rest erledigt Sophie. Sie kauft ein, kocht und trainiert mit ihr das Aufstehen, Gehen und die Sprache. “Mir war wichtig, das es trotz allem eine Distanz zwischen mir und meiner Mutter gibt. Ich denke, sie hätte nicht gewollt, dass ich sie wasche”, sagt sie.
In dieser Zeit macht Sophie eine weitere traurige Erfahrung. Viele Freunde wenden sich von ihr ab. Ihr einst großer Bekanntenkreis ist auf einmal ganz klein. “Mit diesem Verlust musste ich erstmal lernen umzugehen. Ein paar hatten vielleicht einen ähnlichen Fall in der eigenen Familie und wollten damit nicht erneut konfrontiert werden. Andererseits war ich auch nur noch selten mit ihnen unterwegs. Ich hatte abends keine Kraft mehr loszuziehen. Und am nächsten Morgen stand ja um sieben Uhr wieder der Pflegedienst vor der Tür”, sagt sie.
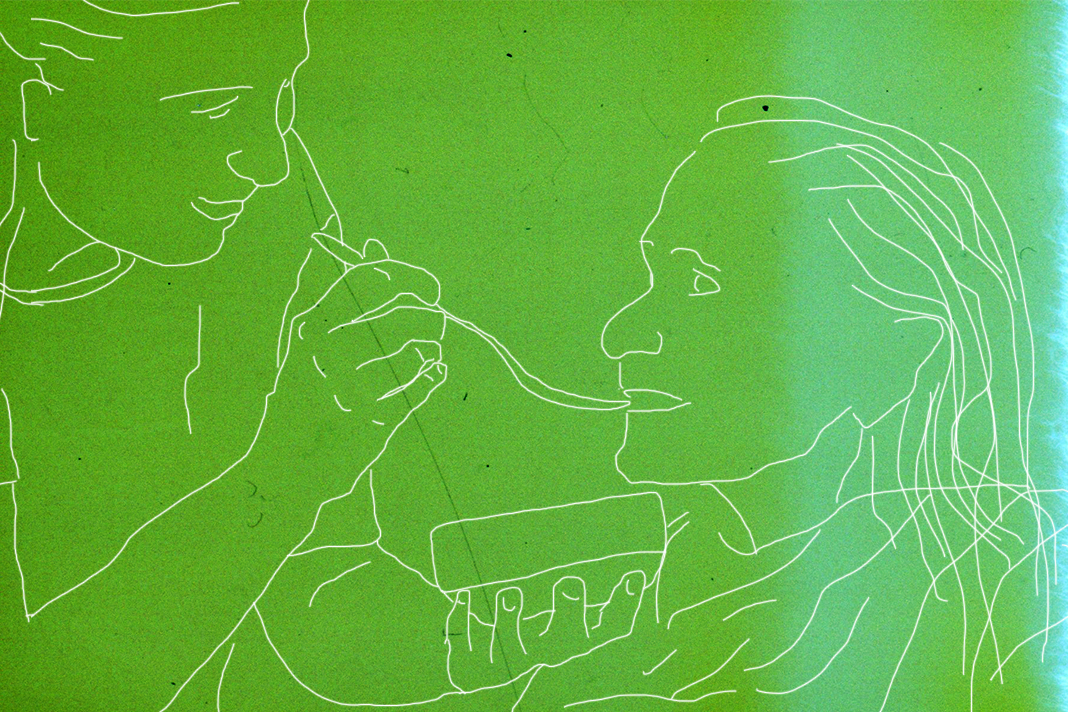
Nach dem Urlaubssemester nimmt Sophie das Studium wieder auf. An zwei Tagen der Woche geht sie an den Campus in der Armgartstraße. Ihre Mutter ist dann in einer Pflegeeinrichtung für Senioren untergebracht. Für Sophie eine Erleichterung, für ihre Mutter eine Belastung: “Das war schon bitter. Meine Mutter haben diese Tage immer sehr runtergezogen. Sie war Anfang 50 und befand sich auf einmal allein unter alten Menschen. Dass das nichts für sie ist, war mir ganz klar”, sagt Sophie.
Für die Dauer des Studiums bleibt jedoch keine andere Wahl. Sophie kann ohnehin nur die Kurse belegen, die zeitlich für sie passen – nicht die, die sie am meisten interessieren. Die Anwesenheitspflicht, für die meisten Studierenden ein lästiges Übel, wird für Sophie zur Belastungsprobe, denn mehr als drei Fehltage darf auch sie sich nicht erlauben: “Dieses System ist überhaupt nicht an die Lebenssituation von Mitzwanzigern angepasst. Das betrifft nicht nur pflegende Studierende, sondern zum Beispiel auch Frauen mit Kindern. Gerade in der Armgartstraße gibt es viele Mütter, die gar nicht klarkommen”, sagt Sophie.
Dozenten ohne Verständnis
Deshalb setzt sich Susann Aronsson vom Familienbüro an der HAW für flexible Studienzeiten, eine gelockerte Anwesenheitspflicht und eine angepasste Prüfungsordnung ein. Sie wirbt außerdem für ein höheres Verständnis bei Dozenten und Professoren für pflegende Studierende. “Wir sind eine familienfreundliche Hochschule und schalten uns bei Problemen auch gerne mit ein”, sagt sie. “Wir helfen bei rechtlichen und finanziellen Fragen, unterstützen bei der Suche nach einem Pflegeplatz oder versuchen, die Pflege zu Hause zu ermöglichen.” Nicht immer gehe es dabei um die Pflege der Eltern oder Großeltern. Häufig sei auch der Partner oder das eigene Kind betroffen, sagt Aronsson. Sie empfiehlt pflegenden Studierenden, sich ein Netzwerk zu suchen, in dem sie sich austauschen können und Unterstützung erhalten.
In Hamburg gibt es zum Beispiel die Arbeitsgruppe jump, die sich speziell für junge Menschen in Pflegeverantwortung einsetzt. Hier hat auch Sophie Hilfe gefunden: “Der Kontakt war für mich sehr wichtig, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht alleine mit meiner Verantwortung bin. Und ich habe gemerkt: Bei anderen ist die Situation teilweise noch viel schlimmer als bei uns.”

Sophie erlebt, dass ihre Lage kein Einzelfall ist. Umso mehr ärgert sie sich über fehlendes Verständnis an der Hochschule. “Wenn ich dann mal von meinen Problemen erzählt habe, haben mich die Reaktionen enttäuscht. In einem Kurs wurde beispielsweise die Kurszeit überzogen, und ich musste dringend los, weil zu Hause schon die Johanniter auf mich gewartet haben. Als ich dann meine Sachen gepackt habe, wurde ich von meiner verärgerten Dozentin angesprochen. Die hat mich nicht ernst genommen und den Grund meines Aufbruchs eher als Ausrede empfunden”, sagt Sophie.
Im Januar 2017 schließt Sophie ihr Modedesign-Studium ab und arbeitet heute in der Modebranche. Sie achtet genau darauf, wem sie von ihrer Situation erzählt. “Meine Arbeit soll nicht von meinem Privatleben überschattet werden”, sagt sie. Inzwischen hat ihre Mutter große Fortschritte gemacht. Sie lebt wieder alleine, kann laufen und einzelne Wörter sagen. Zu Hause hilft ihr eine Pflegekraft im Haushalt und beim Einkaufen. Körperpflege und Kochen bewerkstelligt ihre Mutter ganz selbstständig.
Sophie hat durch diese positive Entwicklung ein Stück Freiheit zurückgewonnen und etwas Wunderbares wiederentdeckt: “Jetzt darf ich zu Hause endlich wieder Tochter sein.”
*Name von der Redaktion geändert
Christoph Petersen, Jahrgang 1989, liebt Bahnfahren und zahlt gerne seinen Rundfunkbeitrag. Spießig? Von wegen: Der Wiesbadener war sogar schon mal in der „Neon" als Single bei den „Ehrlichen Kontaktanzeigen“. Nach seinem Politik- und Soziologie-Studium in Mainz arbeitete Christoph als Hörfunkredakteur und -Moderator für hr1, bevor er sein Volontariat bei einer Produktionsfirma für Dokumentarfilme abschloss. Jetzt lebt er in der „Barmbronx" im Osten Hamburgs und bummelt lieber über den Flohmarkt beim Museum der Arbeit als über den in der Schanze. Dort sucht er vor allem nach alten Schallplatten, die Kindheitserinnerungen wecken.