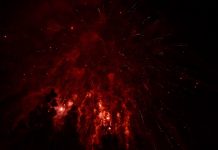Mila hat nie mehr als zwei Jahre am gleichen Ort gelebt. Sie ist Veränderung gewöhnt. Wenn sie von den Konsequenzen der Corona-Krise spricht klingt das positiv – nach Neustart und Transformation.
„Island Vibes“ heißt die Playlist, deren Bässe aus dem Haus am Prüßsee wummern. Immer wenn Mila den Raum wechselt, startet sie sie auf einem weiteren Lautsprecher, immer von vorn. Im Garten hört man dann ein asynchrones Musikchaos. Es mischt sich mit dem Kreischen von Gänsen und dem Klackern von Leinen an Segelmasten. Darüber flattert die Flagge von Trinidad und Tobago. Fast kann man den Cuba Libre schmecken. Die Corona-Krise fühlt sich weit weg an.
Milas Großvater hat das Haus in Güster gebaut – auf halber Strecke zwischen Hamburg und Schwerin. Heute wohnt ihr Vater dort mit ihrer Stiefmutter und Halbschwester. Mila ist aus ihrem WG-Zimmer in Hamburg zu ihnen geflüchtet, als die Stadt wegen der Corona-Krise immer enger zu werden schien.
„Ich hab’ mein Leben lang alle zwei Jahre wo anders gelebt.“
Mila verbrachte den Großteil ihrer Kindheit auf dem Wasser. Sie spricht über die Boote Soliloquy oder Tabasco wie über Familienmitglieder. Als junger Mann hatte ihr deutscher Vater die Welt umsegelt, bis er sich in die karibischen Frauen verliebte. Man könnte eine Telenovela drehen über die komplizierte Familienkonstellation und die Kindheitsabenteuer in der Karibik. Ganz normal in einer Kultur, die vom „Liming“ lebt.
Liming bedeutet abhängen, gesellig sein – und ist doch viel mehr. „Die meisten wohnen in einem Scheiß-Zuhause, in Wellblechhütten. Nach der Schule geht keiner da hin, sondern mit Freunden an den Strand. Das eigentliche Zuhause sind die Freunde“, erklärt Mila. Aktuell ist das Sozialleben in Trinidad und Tobago genauso eingeschränkt wie in Deutschland. Es fällt den Menschen schwer, aber sie halten sich an die Regeln. Vor allem, meint Mila, weil dort niemand sein Leben dem Gesundheitssystem anvertrauen will.
„Du willst da nicht krank werden, selbst normalerweise nicht.“
Milas erste Erinnerung stammt aus einer Zeit, in der sie in der Karibik bei ihrer deutschen Großmutter lebte. Christa, die Mutter von Milas Vater, war Deutschlehrerin und verbrachte ihrer Enkelin zuliebe jährlich sechs Monate in Trinidad und Tobago. Dank ihr konnte Mila Deutsch sprechen lernen und mit 16 Jahren nach Deutschland ziehen.
FINK.HAMBURG hat 24 Menschen gefragt, wie sich ihr Leben durch die Corona-Krise verändert hat. Geführt haben wir die Gespräche via Skype, Zoom, im engsten Bekanntenkreis, denn wir mussten Abstand halten. Herausgekommen sind dennoch Nahaufnahmen von Hebammen, Lehrkräften, Krankenpfleger*innen, Studierenden. Sie zeigen, wie herausfordernd das Virus für den beruflichen und privaten Alltag ist und wie Neuanfänge gelingen.
Der Umzug war ein Schock. Mila fand „das System“ in Deutschland unlogisch. Zum Beispiel als sie in Biologie eine schlechtere Note bekam, weil sie Rechtschreibfehler gemacht hatte. Nicht, dass es in Trinidad und Tobago fairer wäre – im Gegenteil. Doch Kritik an der Obrigkeit gehört dort zum Alltag. Die Deutschen hinterfragen nicht genug, findet Mila.
Die Corona-Krise zeigt, wie zerbrechlich das System ist, sagt sie. Dabei klingt sie begeistert, als ginge es um ein großes Abenteuer. Die letzten Wochen beweisen ihr, dass gesellschaftliche Kehrtwenden möglich sind. Das gibt Mila Hoffnung, zum Beispiel für die Umwelt. Nun müssten die Menschen sich auf das Wesentliche konzentrieren und bewusster vorangehen.
Mila findet, dass die Krise vieles als verzichtbar enttarnt – ihren eigenen Job inbegriffen. Als freie Mitarbeiterin ist sie für das Marketing eines Hamburger Start-ups zuständig. Seit der Corona-Krise engagiert ihr Chef sie für halb so viele Stunden wie sonst. Das Unternehmen lebt eigentlich von Events und Networking. Jetzt kämpft es, um weiter einen Mehrwert zu bieten.
„Die Welt, die wir kennen, ist vorbei.“
Wenn Mila darüber spricht bewegt sich ihr ganzer Körper. Sie schiebt die Sonnenbrille in ihren Afro und setzt sich aufrecht hin. Ihre Hände gestikulieren eifrig. „Ich glaube es ist mit der Erde genauso wie mit unserem Körper: Er gibt dir Warnzeichen und wenn du nicht darauf hörst, bricht er irgendwann zusammen. Wie ich mit meinen Panikattacken.“
Mila hatte jahrelang gekifft. Als sie 2017 damit aufhörte, musste sie sich plötzlich wieder ihren Emotionen stellen. Ihr Körper reagierte so heftig, dass Mila dachte sie müsste sterben. Ärzt*innen in Hongkong behandelten sie mit Diazepam und Amphetamin. Die Medikamente beeinträchtigten Milas Sinne; sie fühlte sich fremd im eigenen Leben. Dann entdeckte Mila Achtsamkeit für sich. Mit Hilfe einer Therapeutin fand sie darin Zugang zu sich selbst – und ihren Lebenssinn. Meditation, Körperreisen und Yin Yoga gehören seitdem zu ihrem Alltag.
Für Mila war dies das körperliche „Jetzt reicht’s“, das sie gebraucht hatte. Sie glaubt, dass die Situation rund um Corona auch ein „Jetzt reicht’s“ ist. Nun seien die Menschen endlich gezwungen, nach innen zu schauen.

„Ich liebe Corona“, lacht Mila und zuckt entschuldigend mit den Schultern. Sie liebt, dass alle sich zurückziehen müssen und der Alltag einen Zwangsstopp einlegt. Sie trauert, um diejenigen, die an dem Virus sterben. Und ja, sie hat auch Angst um geliebte Menschen – aber nicht mehr als sonst. „Meine Oma ist an Krebs gestorben. Seit sie 18 war hat sie jeden Tag ‘ne Schachtel Zigaretten geraucht. Da hätte ich auch die ganze Zeit davor schon Angst haben können.“
Mila war 2015 dabei, als ihre Großmutter Christa starb. Kurz vorher hatte Christa sie gefragt: „Machst du das, was dich glücklich macht?“ Die Antwort lautete Nein. Mila studierte damals Biochemie, wollte aber etwas Kreatives machen. Ihre Großmutter hatte ihr das ausgeredet; nun ermutigte sie sie dazu.
„Damit hat sie mich befreit!“, sagt Mila und vor Enthusiasmus knallt ihre Hand gegen die Fensterscheibe hinter ihr. Sie sitzt auf dem grünen Sofa ihrer Oma. Über eBay Kleinanzeigen hat sie eine Jazzgitarre erstanden. Jetzt stimmt Mila Krista Grote darauf ein selbstgeschriebenes Lied an: „Corona virus, what about the rest of our pain? Open your eyes to our fucked up ways.“
Am liebsten genießt Pia Röpke, geboren 1993 in Hamburg, die Ruhe und meditiert. Nach der Ausbildung zur Medienkauffrau beim Spiegel schlug sie ein Jobangebot dort aus und entschied sich stattdessen für die Universität. Beim Thema blieb sie aber: In Lüneburg studierte sie Digital Media, in Hongkong Creative Media. Dort entdeckte sie Achtsamkeit, Yoga und Spiritualität für sich. Das half ihr dabei, sich zu entspannen, wenn die gierige Millionenstadt zu stressig wurde. Seitdem ist sie überzeugt, dass Selbstreflexion nicht nur für sie heilsam ist, sondern auch für den Rest der Welt wichtig wäre, um die Digitalisierung sinnvoll zu gestalten. Um Digitales und Fundraising kümmert Pia sich für die Organisation Kanduyi Children e.V., die Kindern in Kenia Bildung ermöglicht. Kürzel: pia