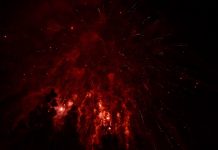Kreischende Kinder, klebrige Sonnencreme auf der Haut und der Gang zum Wasser gleicht einem „Walk of Shame“. FINK-Autorin Jule geht eigentlich gar nicht gern ins Freibad, landet aber immer wieder dort. Warum denn bloß?
Mit frühen Freibaderfahrungen verbinde ich nicht spaßige Arschbomben vom Drei-Meter-Brett zu machen oder eine leckere Portion Pommes rot-weiß vom Kiosk zu essen. Ich denke daran, das Handtuch fest um meinen halbnackten Körper zu binden und mich von den “Coolen” angaffen zu lassen. Und, wenn ich es bis ins Schwimmerbecken schaffe, komplett im Wasser zu verschwinden – und als Letzte wieder rauszukommen.
Ich habe ein Freibadtrauma. Schuld ist meine Jugend als übergewichtiges Mädchen. Wahrscheinlich auch die pubertären Jungs, die mir das Leben damals nicht gerade erleichterten. Aber eigentlich kann das arme Freibad gar nichts dafür – denn Freibäder sind doch ziemlich cool. Oder?
Baden im Sommer: mitgehangen, mitgefangen
Wenn die Temperatur auf 25 Grad klettert, radeln alle meine Freund:innen an einen Badesee oder eben ins Freibad. Auch wenn mich eigentlich beide Optionen nicht sonderlich begeistern, ist mir das nahegelegene Freibad meist doch lieber, als der weit entfernte See.
Was dieses Jahr noch für’s Freibad spricht: Es wird weniger voll sein, vielleicht sogar keine ewig lange Warteschlange vorm Eingang geben. Tickets für Hamburger Freibäder kann man nun auch online kaufen. Ob die genauso schnell ausverkauft sein werden, wie die Tournee der kürzlich wiedervereinten Spice Girls – es waren 38 Sekunden – ist gar nicht mal so unwahrscheinlich.
Hier ist kein Platz für dich, Schätzchen
Was nervt, ist die Suche nach einem Platz auf der Wiese: Ein bisschen Sonne, ein bisschen Schatten, am besten unter einem Baum – blöd nur, wenn dort bereits Muttis mit Kinderwagen und Babyshop-Montur einen „Playground“ für ihre Sprösslinge errichtet haben. Oder wenn Omis und Opis ihre 70er-Jahre Klappstühle mit Blumenmuster und Kaffeekanne so weit auseinanderstellen, dass sie unterschwellig vermitteln: hier ist kein Platz mehr, Schätzchen.
Dann wohl doch irgendwo in der Masse das Handtuch ausbreiten und darauf hoffen, dass das letzte grüne Stück um mich herum auch grün bleibt. Wie gut, dass mein Handtuch groß genug ist – Abstand zu anderen Besucher:innen war mir schon vor Corona wichtig.
Da liege ich dann, fast entspannt. Sobald die Frage „Wer hat Bock mit ins Wasser zu kommen?“ gestellt wird, löst das wieder mein Trauma aus. Aber ich komme trotzdem mit, schließlich ist es viel zu warm, um in der prallen Sonne zu verweilen. Außerdem bin ich keine Spielverderberin und meinen Freunden ist es völlig egal, ob sich meine Oberschenkel beim Gehen zusammenreiben oder nicht. Also aufrichten und los geht’s.
Taucht unter, liebe Selbstzweifel
Da stehe ich also. Vor diesem riesigen Pool: Um mich herum planschende Grundschüler*innen, Macho-Jungs, die kichernde Mädels vom Beckenrand rein schubsen – und eben ich, die versucht, nicht so unsicher wie mit 14 Jahren zu sein.
Ich lasse mir nichts anmerken, gehe bestimmt die Treppen hinunter und genieße das kühle, chlorhaltige Wasser.
Genieße die Zeit mit meinen Freund:innen.
Genieße die Sonne, die die Wasserperlen auf meiner Haut in Sekunden trocknen lässt und die Stille beim Abtauchen, die beim Auftauchen zu hellem Gelächter anschwillt.
Dann merke ich: Das Freibad ist nicht so furchtbar, wie ich es mir vor jedem Besuch vorstelle.
Am meisten freue ich mich aber auf die Rückkehr zum Handtuch: Musikbox aus der Tasche, Sommermusik an, Cider-Dose auf – und das am besten bis zur Abenddämmerung.
Und plötzlich, zwischen all den Personen, denen ich wichtig bin, verschwimmen meine Selbstzweifel. Ich spiele Volleyball, lache und schaffe neue Erinnerungen. Ich esse Pommes, spüle Cola hinterher und springe vom Ein-Meter-Brett. Der Ort ist völlig egal, solange die richtigen Personen mit dabei sind.
Titelbild: Unsplash
Julia Rupf, Jahrgang 1995, hat Xavier Naidoo aus der Jury von DSDS geschrieben. Sie berichtete als Erste über seine Verschwörungstheorien. Außerdem hat sie bereits Will Smith interviewt und kommt aus der gleichen Kleinstadt wie die Rapper Shindy, Bausa und RIN: Bietigheim-Bissingen. Weil sie auch ansonsten keine Angst vor großen Namen hat, schreibt sie alles (Un-)Wichtige aus der Welt der Promis für die „Hamburger Morgenpost“, die „Gala“ und TV-Movie.de auf. In Hamburg ist Jule irgendwo zwischen Punk, Kickboxen und Hip-Hop unterwegs. Hauptsache Subkultur. Nach Jules erstem Tattoo redete ihre Mama eine Woche lang nicht mehr mit ihr, gebracht hat es aber nichts: Inzwischen hat sie vierzehn davon.
Kürzel: jup