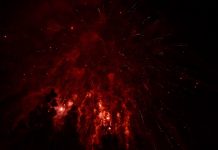Der Biber breitet sich in Hamburg immer weiter aus. Das gefällt nicht allen. Dabei bringt der Biber viel für den Naturschutz. Unterwegs mit einem, der zwischen Mensch und Biber vermittelt.
Montage Titelbild: Jana Rogmann, Loki Schmidt Stiftung – Moin Biber.
Eigentlich sollte man das Bibergeil riechen können. Mit dem Sekret markiert der Biber sein Revier und pflegt sein Fell. Alina Adler, Studentin, beugt sich aus dem Kanu, greift Schlamm vom Uferrand. „Ne, ich rieche nur Erde.“ An dieser Stelle sei der Biber nachts an Land gegangen, so Frederik Landwehr, Biber-Berater der Loki-Schmidt-Stiftung. Das beweise die sogenannte Biberrutsche: platt gedrückte Erde zwischen den Grasflächen. Landwehr steigt ins Wasser. Es platscht. Das könnte der richtige Ort für eine Fotofalle sein.

Bergedorf. Ein Traktor pflügt das Feld, darüber fliegen Kiebitze. Hier, in den Vier- und Marschlanden, ist der Biber seit 2010 wieder heimisch. 200 Jahre lang war das größte Nagetier Europas quasi ausgerottet. Der Grund: Menschen wollten Pelz, Fleisch und Bibergeil, das als Medikament verwendet wurde. Nur wenige Tiere überlebten an der Mittelelbe in Sachsen-Anhalt. Inzwischen gilt der Biber europaweit als streng geschützt. In Hamburg gibt es wieder knapp zwölf Reviere – ungefähr fünfzig Tiere.
Biber eroberte seine Hamburger Heimat zurück
Während der Biber in anderen Bundesländern, wie Bayern, wieder angesiedelt wurde, eroberte der Hamburger Biber seine Heimat selbständig zurück. Landwehr begleitet den Biber seit dessen Rückkehr. Der Biberberater ist schlicht gekleidet: schwarzes T-Shirt, grüne Hose, blaue Käppi, zwei Ohrringe. Er erfasst den Bestand der Tiere, koordiniert die ehrenamtlichen Revierbetreuer*innen und vermittelt zwischen Bibern und Menschen – indem er Bildungsarbeit leistet und bei Konflikten zwischen Bibern und Menschen schlichtet.

Für seine Übersetzerfunktion hilft es, dass der Biber-Berater ständig in den Revieren unterwegs ist. Ziel der heutigen Fahrt: Fotofallen kontrollieren – zusammen mit Alina Adler. Die 27-Jährige studiert Ökologie und Umweltschutz; sie trägt Wanderschuhe und ihre braunen Haare zum Zopf. Adler schreibt ihre Bachelorarbeit über den Biber und untersucht die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Hamburger Revieren. Sind es Hamburger Jungtiere oder zugezogene Biber, die neue Reviere erschließen? Für die Untersuchung braucht die Studentin Bilder aus den Fallen und DNA-Proben.
Biberburgen an der Dove und Gose-Elbe
Das Wasser des Neuengammer Stichkanals fließt nur langsam. Biber bauen ihre Burgen überwiegend hier am Ufer der Dove- und Gose-Elbe, da die langgezogenen Seen weder Tide noch Strömung haben. Die traurige Geschichte dahinter: Den Stichkanal, ein Arm der Dove-Elbe, mussten die Gefangenen des Konzentrationslagers Neuengamme mit ihren Händen graben. Eine Gedenkstätte erinnert heute an diesen Teil Hamburger Geschichte.
Auf dem Boden liegen Holzspäne. Vögel zwitschern. Aus einem Loch im Baumstamm laufen Ameisen. „Der erste Gedanke ist oft: Ein gefällter Baum ist eine Katastrophe für den Naturschutz. Aber für die Natur ist Totholz total wichtig“, sagt Landwehr, „Sei es für Käfer, Pilze, Wildbienen oder Flechten.“ Wenn der Baum im Stehen abstirbt, entstehen Nistplätze für Spechte. Je länger der Biber an einem Gewässer lebt, desto mehr Fischarten gibt es dort: Die Äste im Wasser bieten Platz zum Leichen.
„Der Biber ist eine Art, die unglaublich
viel für die Natur tut“
Es riecht nach gemähtem Gras. „Totaler Quatsch, warum es wie auf dem Golfplatz aussehen muss“, sagt Landwehr. Immerhin wurde sein Hinweis umgesetzt, nicht ganz bis zum Uferrand zu mähen. Das Landschaftsprogramm der Stadt Hamburg legt fest, dass entlang der Dove- und Gose-Elbe zehn Meter „in auentypischer Weise als Auensaum zu berücksichtigen“ sind. Heißt: Möglichst nicht mähen, nicht fällen, keine Nutzpflanzen. „Der Biber ist eine Art, die unglaublich viel für die Natur tut“, sagt Landwehr. Aber dafür müsse man ihm auch Raum geben.
Biber fressen auch aus Gärten

Das ist nicht immer einfach. „Der Mensch muss wieder lernen mit großen Wildtieren umzugehen“, so Landwehr. Auch wenn der Biber Veganer und dahingehend keine Gefahr ist, wird er bis zu 130 Zentimeter groß und so schwer wie ein Schäferhund. Das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Tieren sei schwierig. Die Nagetiere fressen Mais vom Feld, Obstbäume und Thuja-Hecken aus Gärten. Der 41-Jährige versuche mit allen Beteiligten zu sprechen: Anwohner*innen, Jäger*innen und Landwirt*innen. Für ihn steht fest: „Naturschutz mit Brechstange funktioniert auch nicht.“ Man müsse noch stärker differenzieren, wo Naturschutz beginne und wo Landwirtschaft und Gartenbau aufhöre.
Auf dem Weg zur Gedenkstätte lenkt Landwehr seinen Bulli spontan in eine Schrebergartensiedlung ein. „Länger nichts gehört“, sagt er murmelnd. Hier rief eine Gärtnerin an, weil der Biber ihre Obstbäume gefällt hat. Inzwischen ist ihr Birnbaum unten mit Draht eingehüllt. Laut Landwehr sei der Draht ein „bisschen lütt“. „Aber es scheint ja funktioniert zu haben.” Wer Biberspuren findet: Fotos machen, den Biber-Berater anrufen und die Spuren der Loki-Schmidt-Stiftung melden. “Nicht jede Spur kennen wir schon”, sagt Landwehr.
Gefällte Bäume wie Mikadostäbe
Am Neuengammer Stichkanal liegen die gefällten Bäume wie Mikadostäbe übereinander. Der Biber hat das Pappelwäldchen in den letzten zehn Jahren „komplett weggefressen“. Zwischen den Brennesseln ragen Baumstümpfe wie angespitzte Bleistifte hervor. „Kreativen Chaot“ nennt der Biber-Berater das Nagetier auch liebevoll. Adler hängt ihr Fernglas an einen umgestürzten Baum. „Die Biber wollen die Rinde und das Laub haben“, sagt sie, „Die Äste brauchen sie um ihre Burg auszubessern.“ Der Biber lässt dem Wald aber auch Zeit nachzuwachsen: Die ersten Jungbäume sind schon wieder zwei Meter groß.
Leider ist es heute zu windig. sonst könnte man die Biberfamilie
vielleicht schnarchen hören.
Die Biberburg ist ein Haufen aus Ästen, einer Angel und Stöckchen – so groß wie ein Osterfeuer. Der Eingang zur Burg liegt unter Wasser. In einem Revier leben die monogamen Bibereltern, die Jungtiere aus den letzten zwei Jahren und neue Jungtiere. Leider ist es heute zu windig. Sonst könnte man die Biberfamilie vielleicht schnarchen hören.
Die Biberburgen sind leicht zu übersehen. Erst letztens haben sich Jugendliche daraus Stöcke für eine Feier geholt. Also: Augen auf und nicht auf Burgen treten. Landwehr und Adler laufen zur Fotofalle, die auf Wärme und Bewegung reagiert. Sie öffnen die graue Box, wechseln Batterien und Speicherkarte. Auf den Videos sind nicht nur Biber, sondern auch Kaninchen, Waschbären, Nutrias und Füchse.
Biberkelle in Schwarz-Weiß
Die meisten der 474 Aufnahmen sind schwarz-weiß. Landwehr schaut aufgeregt auf den Laptop: „Oh süß! Solche Bilder wollen wir haben.“ Adler stimmt mit einem „wow“ zu. Auf dem Bildschirm: Die Biberkelle, der breite und flache Schwanz des Bibers, schleift über den Boden. Ein nicht sichtbares Tier kratzt und nagt. Unter dichtem Fell sind die Schwimmhäute klar erkennbar.
Video: Loki Schmidt Stiftung – Moin Biber, Schnitt: Jana Rogmann, Musik: Pixabay (Grand_Project)
An der Stelle mit dem Bibergeil, vor der Biberrutsche, suchen Landwehr und Adler noch lange nach einem Platz für die Fotofalle – „zu viele Angler“. Neben einem Weißdorn werden sie fündig: Die Falle hängt jetzt, mit schwarzem Band und Schloss gesichert, an einem angesägten Baum. Bereit, die nächsten Biber zu filmen.
Jana Rogmann, Jahrgang 2000, aus Kevelaer, ist den Berliner Marathon schon einmal in unter zwei Stunden gelaufen - allerdings auf acht Rollen: im Sportunterricht gab es Inline-Skating als Wahlfach. Nach einem sozialen Jahr an einer Schule in Bolivien war sie sicher, dass sie nicht Lehramt studieren würde. Sie entschied sich für Komparatistik und English Studies in Bonn, arbeitete bei der WDR-Lokalzeit in der Online-Redaktion und moderierte eine Musiksendung beim Uni-Radio. Einzige musikalische Regel: alles außer Schlager. In ihrer Kolumne in der Rheinischen Post schrieb sie mal über “Uni in der Handtasche” in Zeiten der Pandemie, mal über ihr abgeschnittenes Haar. Seit einem Praktikum beim KiKA kann sie perfekt Kinderstimmen imitieren, will aber lieber Journalismus für Erwachsene machen. Kürzel: rog