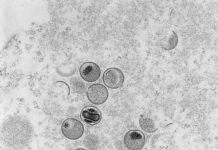Zu Hause zu bleiben und trotzdem für ihre Schüler da zu sein, verlangt der angehenden Lehrerin Mia einiges ab. Als Referendarin muss sie nicht nur ihren Klassen etwas beibringen, sondern auch selbst noch lernen.
12 Uhr. Durch das Mikro des Laptops tönt der Skype-Klingelton. Ein letzter langer Ton kündigt den Verbindungsaufbau an. Noch ein Rauschen, dann erscheint das Gesicht einer jungen Frau. Sie ist ungeschminkt, ihre Haare werden mit einem Haarreifen zurückgehalten. Hinter ihr ist ein Bettrahmen aus Metall zu sehen. Normalerweise wäre Mia* jetzt im Klassenzimmer ihrer vierten Klasse und nicht in ihrem Bett. Aber aufgrund der Corona-Krise war das seit den Märzferien bis Anfang Mai nicht möglich.
Vergrößern

Foto: Privat
Seit neun Monaten ist die 25-Jährige Mathe- und Englisch-Referendarin an einer Grundschule im Osten Hamburgs. Rund 80 Prozent der Kinder an ihrer Schule haben einen Migrationshintergrund, erzählt Mia. Viele Elternteile sprechen wenig bis gar kein Deutsch. Die meisten Familien leben in bescheidenen Verhältnissen. Einige Kinder haben Lernschwächen auf und brauchen besonders viel Aufmerksamkeit: Bei Mia sind es elf Schüler mit offiziellem Förderstatus.
Für Mia ist das eine eher unbekannte Welt. Sie wuchs behütet in einem Einfamilienhaus in der Nähe von Hannover auf, hat ihr Abitur gemacht und ist gereist – vor und während ihres Studiums. Eine solche Perspektive haben nur wenige ihrer Schüler. Und die Corona-Krise macht den Zugang zur Bildung nicht einfacher.
Viele Familien besitzen keinen Computer
„Zu Beginn dachten wir, dass die Schule nur für zwei Wochen nach den Ferien geschlossen bleibt”, erzählt Mia. “Da haben wir uns noch in der Schule getroffen und Materialpakete für die Kinder erstellt, mit Arbeitsblättern und Heften.” Die Eltern mussten diese abholen. So konnten Mia und ihre Kollegen das Lernen zu Hause gewährleisten.
Mit der längeren Schließung der Schulen mussten Alternativen her: „Es gibt Lernplattformen, auf denen wir die Kinder angemeldet haben. Viel läuft über Mail oder Messenger-Dienste.“ Aber viele Kinder haben nicht die technischen Geräte, um auf die Angebote zuzugreifen. Die Schule schafft mit Leihrechner Abhilfe. Die Anzahl ist aber begrenzt. Telefonate mit den Lehrern bleiben vorerst essenziell.
FINK.HAMBURG hat 24 Menschen gefragt, wie sich ihr Leben durch die Corona-Krise verändert hat. Geführt haben wir die Gespräche via Skype, Zoom, im engsten Bekanntenkreis, denn wir mussten Abstand halten. Herausgekommen sind dennoch Nahaufnahmen von Hebammen, Lehrkräften, Krankenpfleger*innen, Studierenden. Sie zeigen, wie herausfordernd das Virus für den beruflichen und privaten Alltag ist und wie Neuanfänge gelingen.
Von 8 Uhr bis 16 Uhr muss Mia im Homeoffice für die Eltern und Kinder erreichbar sein. In dieser Zeit fragt sie Lernfortschritte ab und erkundigt sich nach Fragen und Problemen. Wenn die Eltern kein Deutsch sprechen, werden Geschwister zu Dolmetschern. Etwa drei bis fünf Telefonate führt sie am Tag. Noch hat sie kein Diensthandy. Um dennoch mit Schülern und Eltern in Kontakt zu bleiben, hat sie ihre Privatnummer herausgegeben.
Die Folge: Beruf- und Privatleben lassen sich schlecht trennen – einen festen Feierabend gibt es nicht mehr. Zu jeder Tageszeit erhält sie Nachrichten oder Anrufe der Eltern. Selten sind es dringende Dinge, die es zu besprechen gibt. Genervt sei sie nicht, aber schön sei es eben auch nicht, sagt sie lachend. Die späteste Nachricht die bisher bei ihr einging kam um 22.15 Uhr: Fotografien von fertiggestellten Lernzetteln.
Die Eltern haben ihre Privatnummer
Trotz der Umstände sieht die angehende Lehrerin das Positive: „Die Eltern sind bisher nicht überfordert. Ich hab noch keine negative Erfahrung gemacht, dass hört man ja mal von anderen. Ich persönlich kann mich da nicht anschließen. Sowohl ihre Schüler, als auch die Eltern seien engagiert bei der Sache.

Foto: Privat
Genauso erfreulich: Viel positives Feedback und Wertschätzung sei ihr entgegengebracht worden. „Die Eltern merken, wie es ist, Schüler zu unterrichten und wir Lehrer haben nicht nur einen, sondern gleich 30 davon!“ Auch ein wenig Stolz schwingt in ihrer Stimme mit.
Jetzt gerade fühlt sich Mia eher wie eine ausgebildete Fachlehrerin und nicht wie eine Referendarin. Dennoch muss sie neben der Betreuung ihrer Klassen auch selbst noch Seminare besuchen. Diese finden nun online statt. Das ist anders bei den vom Schul- und Seminarleiter besuchten Unterrichtseinheiten, welche in Mias Beurteilung als angehende Lehrerin einfließen. Drei ihrer elf Unterrichtsbesuche sind bereits ausgefallen.
Dass diese Präsenzphasen fehlen, bedauert sie am meisten. Ihre erste Prüfung für das Staatsexamen am 5. Mai musste verlegt werden – ins neue Schuljahr. Sie wird sie dann mit einer neuen vierten Klasse ablegen. Eine Klasse, die sie bis dahin nicht ein Jahr, sondern nur ein paar Wochen begleiten wird.
Homeschooling ist nur eine Notlösung
Trotz allem: Mia liebt ihren Beruf weiterhin. Der Wunsch der Schüler wieder in die Schule zurückzukehren, ist das beste Zeichen dafür, dass sie etwas richtig macht. Auch sie kann die Wiedereröffnung der Schule kaum erwarten: „Homeschooling ist eine Notlösung, die momentan gut klappt, aber die in keiner Weise den normalen Unterricht ersetzt“, sagt sie.
Es ist 12.30 Uhr. Mia verabschiedet sich. Es ploppt nochmal, dann verschwindet ihr Gesicht. Sie muss wieder arbeiten. Lernzettel korrigieren, Schüler anrufen und Materialien erstellen. Ihr Arbeitsplatz ist ihr Bett, ihr Schreibtisch und der mit Lernmaterialien ausgelegte Boden. Neben ihr liegen ihr Handy und ihr Laptop. Erreichbar ist sie die ganze Zeit.
*Name geändert
Christina Göhler, 1996 im Emsland geboren, weiß alles über Bier, denn ihr Studium in Siegen - Medienwissenschaft, Literatur, Kultur und Medien - finanzierte sie mit Führungen durch eine Brauerei. Als Praktikantin in einer Produktionsfirma schrieb sie Drehbücher für ein Trash-TV-Format von Sat.1. Für die „Hamburger Morgenpost“ produzierte sie Videos – unter anderem eines, in dem sie gegen einen „Ninja Warrior“-Finalisten antrat und krachend verlor. Schon auf sechs Kontinenten hat Christina mittlerweile ihren Campingkocher aufgestellt, nur die Antarktis fehlt ihr noch. Trotz dieses Freiheitsdrangs lässt Christina sich gerne einsperren – bislang hat sie aber noch jeden Escape-Room geknackt. Kürzel: cgö